In dunklen Höhlen wohnt edles Gestein

Seit Jahrtausenden gaben sich Menschen bewusst der Einsamkeit hin, um Erkenntnisse zu erlangen. Wie sie zum Problemkind wurde, das sie nicht sein muss. Zumindest nicht nur.
Mein grosser Bruder sagte mir mal: «Das Studium ist die beste Zeit deines Lebens. Einen oder zwei Tage die Woche lernst du, die anderen machst du Party.» Aus heutiger Sicht ganz schön erdrückend, nicht?
Vielleicht ging’s dir anders, aber meine letzten beiden Jahre waren ein gemischtes Erlebnis. Die Toleranzgrenze für Online-Meetings war oft überschritten, Verbindung zum «Leben» dringend nötig. Ich erinnere mich an mehrere Momente, in denen ich mir überlegte, in den Zug nach Spanien zu steigen, um zu schauen, ob mich jemand vermissen würde.
Jetzt, ein Jahr nach der Selbstdiagnose und Therapiebeginn, will ich Einsamkeit von ihrer Schokoladenseite beleuchten.
Facetten der Einsamkeit
Da die Datenerhebung zu Einsamkeit erst knappe 50 Jahre alt ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, ob das Gefühl gerade eine Hochkonjunktur erlebt. Was sich aber verändert hat, ist die Auffassung von Einsamkeit.
In einem Interview mit der Uni Bern beschreibt Psychologin Noëmi Seewer Einsamkeit als «sozialen Durst» und als Warnsignal, welches Menschen auf ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit aufmerksam macht – ein an sich nützlicher Motivator für soziale Interaktion. Halte das Gefühl jedoch über längere Zeit an, führe es zu einem hohen Leidensdruck. Eine Vielzahl an Studien belegen, dass langanhaltende Einsamkeit zu Ess- und Schlafstörungen, Demenz und Depressionen führen kann.
«Um die Einsamkeit ist’s eine schöne Sache, wenn man mit sich selbst in Frieden lebt und was Bestimmtes zu tun hat.» – Goethe (1749 – 1832)
Die Gefährlichkeit von Einsamkeit ist inzwischen so bekannt, dass wir das Wort mit einer inhaltlichen Selbstverständlichkeit verwenden. Dabei ist der Fall alles andere als klar. So wird beispielsweise im Englischen unterschieden zwischen «loneliness», «lonesomeness» und «solitude». Während die ersten beiden Begriffe unserer leidzentrierten Auffassung von Einsamkeit entsprechen, bedeutet «solitude» ein Für-Sich-Sein, oft selbstgewählt in der Abgeschiedenheit. Einsamkeit, die freiwillig gewählt wird und nach Gutdünken beendet werden kann, ist grundlegend anders als die Einsamkeit, die sich anschleicht, um zu verschlingen. Es ist Einsamkeit im Sinne von «solitude», derer sich dieser Text widmet.
Früher: alles besser, aber auch einsam
Für viele Philosoph*innen war Einsamkeit ein süss-saures Gefühl. Nietzsche zum Beispiel hat Einsamkeit in ihren dunkelsten Abgründen durchstanden und in ihren befreiendsten Formen gefeiert. Er entwickelte dabei nicht nur eine ganze Palette an Einsamkeitsypen – darunter die «azurne Einsamkeit» und die «einsamste Einsamkeit» –, sondern kam auch zum Schluss, dass im Schaffungsprozess von Neuem kein Weg an der Einsamkeit vorbeiführt.
In der Einsamkeit erkennt der Mensch eigene Denk- und Wertungsmuster und kann sich leidvoll davon lösen. In anderen Worten: Wenn wir uns dem sozialen Kontext entziehen, können wir erkennen, wie dieser uns formt. Doch «produktive» Einsamkeit geht über das Alleinsein hinaus. Es sei ein tiefer, innerer Prozess, sagt Matthew Bowker, ein politischer Theoretiker, der Einsamkeit untersucht. Bevor dieses Für-Sich-Sein eine «angenehme» Erfahrung werde, sei eine innere Erforschung nötig: eine Art Arbeit, die qualvoll sein kann.
«Ich lebe in jener Einsamkeit, die peinvoll ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife.» – Albert Einstein (1879 – 1955)
Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen, die sich in die erkenntnisreiche Stille verlieben. So schreibt Autor und Mönch Thomas Merton: «I am just beginning to really get grounded in solitude, so that if my life were to be on the way of ending now, this would be my one regret. Loss of the years of solitude that might be possible.» Ähnlich erging es wohl den vielen Geistlichen – inspiriert von Mohammed, Buddha und Jesus –, die sich in Wüsten und Wälder begaben, um dort in Einsamkeit Erleuchtung zu finden. Und noch heute gibt es Klosterorden, die Einsamkeit fördern. So besagen die Statuten der Kartäuser: «Unser Bemühen und unsere Berufung bestehen vornehmlich darin, im Schweigen und in der Einsamkeit Gott zu finden.»
Als eine Koryphäe der Einsamkeit gilt es ausserdem Michel de Montaigne hervorzuheben. 1571 zog sich der damals 38-jährige, frisch gekündigte Parlamentarier in einen Turm zurück, wo er den Grossteil der neun darauffolgenden Jahre verbrachte. Nur durch die Entsagung menschlicher Kontakte und sozialer Verpflichtungen, so Montaigne, sei es möglich, das eigene Leben zu untersuchen, Verhaftungen zu lösen und Frieden zu finden. Heraus kam er mit zwei geschichtsträchtigen Essay-Sammlungen (und einem sehr schmerzhaften Nierenstein).

Einsamkeit ist nicht nur finster, sie kann auch eine Reise sein. (Bild: zvg)
Hiebe der Liebe
Nebst der Liebe zu Gott machte sich im 19. Jahrhundert ein neues Liebeskonzept breit: die unsterbliche Liebe zu Mit-Sterblichen. Und damit änderte sich auch die Sichtweise auf Einsamkeit.
Erst im Kontrast zur Zweisamkeit wird Einsamkeit als negativ empfunden. Deshalb ist das Entstehen der romantischen Liebe als legitimes Konzept entscheidend. War es während der Vormoderne noch üblich, arrangierte Ehen einzugehen, bei denen Liebe als Tugend nach der Vermählung verstanden wurde, so begann mit der romantischen Epoche ein Sinneswandel: «Zuerst die Liebe, dann die Heirat». Wenn schon vor dem 19. Jahrhundert die «wahre» Liebe existierte: so bestand nun ein Anspruch darauf. Von Beatles-Songs wie «All you need is love» (sowie 99% aller anderen Pop-Songs), bis hin zu 99% der Disney Prinzessinnen-Filme (abgesehen von «Ralf Reichts») – die Popkultur feiert romantische Liebe noch heute ab. Sogar Vampire, die ehemals einsiedlerischen Grafen der Finsternis, werden neulich als sozial und sexy dargestellt.
Die Auswirkung auf unseren Umgang mit Einsamkeit ist beachtlich. Je mehr die Liebe zur Voraussetzung für ein glückliches Leben standardisiert wird, desto bemitleidenswerter wird das Alleinsein.
Heute: Gruppenorientiert, aber auch einsam
Eine weitere wichtige Entwicklung war die Industrialisierung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Menschen zogen in die wachsenden Städte, wo sie sich gegen eine Vielzahl anderer Arbeitskräfte behaupten mussten. Wer erfolgreich sein wollte, musste hervorstechen, sozial sein und Charisma zeigen. Die Autorin Susan Cain beschreibt dies als einen Wandel von einer «Culture of character» hin zu einer «Culture of personality», der begründet, warum heutzutage Extrovertiertheit positiver bewertet wird als Introvertiertheit.
Einen Freitagabend lesend zuhause zu verbringen oder eine Woche alleine campen zu gehen, erhält einen komischen Charakter. Ungerechtfertigt? Einsamkeit, so Matthew Bowker, wurde seit langem nicht so abgewertet wie heute. Wir seien eine gruppenbezogenere Gesellschaft geworden, in der sich Individuen zu Gemeinschaften hingezogen fühlten, die ihnen bei der Selbstdefinierung helfen. Einfach gesagt bräuchten wir andere, um unsere Identität zu bauen.
«Das Erlernen der Einsamkeit ist eine Kraft und nicht ein Ziel.» – Élisabeth Badinter (1944 – heute)
Könnte Gruppenorientiertheit der Grund sein, warum Einsamkeit stigmatisiert wird? Die Verbindung zwischen Scham und Einsamkeit wird in zahlreichen Studien hervorgehoben. Doch die Geschichte zeigt: Das Bündnis ist keinesfalls naturgegeben.
Es ist an der Zeit, die beiden zu trennen und das Image der Einsamkeit zu rehabilitieren! Wir brauchen eine Welt, welche die Normalität von Einsamkeit anerkennt, ohne sie unter den Teppich zu kehren. Und wir brauchen dringend mehr Wertschätzung und Akzeptanz fürs Einsamsein. Menschen, die beim sozialen Dauergeplapper mal aussetzen, sind nicht unhöflich, asozial oder langweilig. An all jene, die jenseits der Isoliertheit etwas Gutes in der Einsamkeit finden: Ihr habt das Recht dazu, diese von Zeit zu Zeit aufzusuchen. An all jene, die unter Einsamkeit leiden: Ihr dürft euch Hilfe holen. Und an die Club-Crawl-Athlet*innen, die fünf Mal die Woche die Nacht beleben: Ihr habt Respekt verdient. Aber es ist an der Zeit, die Ehre mit den Menschen zu teilen, die Erleuchtung fern der bunten Lichter suchen.
text: florian rudolph
***
Falls Einsamkeit überhand nimmt
The Student Minds Project ist eine nationale Kampagne zur psychischen Gesundheit von Studierenden an Schweizer Hochschulen. Ihr Ziel ist es, die mentale Gesundheit ohne Stigmatisierung und Hindernisse
zu fördern.
SOLUS ist eine Selbsthilfeintervention zur Reduktion von Einsamkeitsgefühlen. Sie wurde dieses Jahr an der Uni Bern gestartet.
***
Dieser Beitrag erschien in der bärner studizytig #25 Oktober 2021
Die SUB-Seiten behandeln unipolitische Brisanz, informieren über die Aktivitäten der Studierendenschaft der Uni Bern (SUB) und befassen sich mit dem Unialltag. Für Fragen, Lob und Kritik zu den SUB-Seiten: redaktion@sub.unibe.ch
Die Redaktion der SUB-Seiten ist von der Redaktion der bärner studizytig unabhängig.



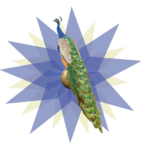



Was für ein Geschenk ist dieser Text, der nachdenklich macht … Danke Florian Rudolph für so viel Tiefsinn und Schönheit der ernsten und ernstzunehmenden Gedanken.