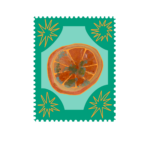Die Verhandlung meiner Privilegien: Log-Buch eines weissen Studenten

Als mir die SUB-Redaktion das Privileg erteilte, über Privilegien schreiben, ahnte ich noch nichts von dem nervenaufreibenden Prozess, der mich erwartete. Doch jetzt ist klar: Privilegien zu erkennen ist einfach, einen Umgang mit ihnen zu finden schwierig. Eine persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, warum wir uns so schwer tun, über unsere «unverdienten Vorteile» zu sprechen.
Die letzten 12 Monate habe ich in Berlin gelebt: in Berlin, wo du sein kannst, wie du bist und dich niemand schräg anschaut, wenn du im Pyjama auf die Strasse gehst. Natürlich bezweifle ich das inzwischen, aber dazu später mehr. In Berlin gibt es ein Quartier namens Neukölln, in dem so viele arabisch-sprechende Menschen leben, dass sich die Sprache bereits auf Hinweistafeln und Wurfzetteln durchgesetzt hat. Hier begann meine Auseinandersetzung mit Privilegien. Der Prozess war für mich herausfordernd und ist noch lange nicht vorbei. Doch werde ich versuchen, so ehrlich wie möglich davon zu berichten und hoffe, dass du etwas daraus gewinnen kannst!
Nadja Shehadeh, Autorin und Soziologin, beschreibt Privilegien als «[…]unverdiente Vorteile, die eine Person geniesst.» Je nachdem, welche Ausgangsprivilegien eine Person besitzt, so Shehadeh, ist es möglich, im Laufe der Zeit weitere Privilegien dazuzugewinnen. Ein Traumjob beispielsweise ist nicht nur den eigenen Leistungen zu verdanken, sondern auch auch den Startbedingungen. Interessant ist dabei: Oft sind sich Menschen ihrer Privilegien gar nicht bewusst. Und wenn mensch sich doch bewusst wird?
0: Unsichtbare Privilegien

In der linken Spalte beschreibe ich meine persönliche Erfahrung.
Ich bin weiss. Das Wort soll kursiv und klein geschrieben werden, um zu zeigen: Um Hautfarbe geht es nur an der Oberfläche. Dahinter stecken soziale Konstrukte.
Auch das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist sehr weiss. In der Primarschule gab es in meiner Klasse ein Kind aus Albanien und eines aus Mazedonien, in der Mittel- und der Oberstufe bestand meine Klasse nur aus Schüler*innen mit Schweizer Wurzeln. Es war eine sehr unbeschwerte Zeit und ich fühlte mich unbefangen und vertraut mit Menschen, egal welche Hautfarbe sie hatten. In dieser Zeit sah ich Menschen als Menschen.
Oder doch nicht? Ich frage mich, warum ich kaum Kontakt mit meinen nicht-schweizerischen Klassenkameradinnen hatte. Vielleicht war es die Sprache. Vielleicht war es die strenge Linie zwischen weiblich und männlich gelesenen Schülerinnen in der Primarschule Lärchenfeld. Aber da war noch etwas anderes. Ich erinnere mich an die schwarzen Haare und die blasse Haut und wenn ich ehrlich bin, wusste ich nicht so wirklich, was anfangen mit diesen Menschen. Ich hatte zu der Zeit keine Fragen parat, kein Verständnis für Migration und keine Geduld, mich auf einen Austausch einzulassen, der sich nicht um meine Welt drehte. Ich interessierte mich für Klingelstreiche und Walkie-Talkies.
In der rechten Spalte kommen Aussenperspektiven dazu.
Tupoka Ogette, eine rassismuskritische Autorin beschreibt den Zustand von weissen Menschen vor einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus als «Happy Land»: Als weisser Mensch muss ich mich nicht mit Rassismus auseinandersetzen, wenn ich das nicht möchte. Es ist ein Problem, von dem ich mich bewusst oder unbewusst abwenden kann. Ich kann beschwichtigend sagen: Ja, es gibt rassistische Menschen, aber das sind ein paar wenige und ich bin ja offen. Sollte ich gerade eine schwere Zeit haben, kann ich das Thema Rassismus auch mal vergessen. Bei Menschen, die aufgrund von ihrem Aussehen, ihrem Namen oder ihrer Herkunft aus der «weissen Norm» fallen, ist das anders: Aufgrund rassistischer Übergriffe und systemischem Rassismus müssen sie sich zwangsläufig damit auseinandersetzen.
Dies sind Beispiele für sogenannte «weisse Privilegien»: mehr Chancen beim Finden einer Wohnung oder bei Bewerbungsprozessen, keine Angst vor rassistischen Übergriffen in Clubs, passende Pflaster zu meiner Hautfarbe… Dadurch, dass ich weniger oft gefragt werde, woher ich komme, muss ich nicht an meiner Zugehörigkeit zweifeln. Das bedeutet noch lange nicht, dass mein Leben ein leichtes ist, aber zumindest gehört Rassismus nicht zu meinen alltäglichen Sorgen.
1: Privilegien erkennen

15 Jahre später: Auf Ok-Cupid, der Go-To-Datingplattform in Berlin, hatte ich einen Match mit einem Menschen, der die Auswahl-Antwort «links-liberal» auf «links» korrigiert hatte. Das gefiel mir. Und er kam von Neukölln. Bei unserem ersten Date kochte er für mich ein Dahl. Ich fragte nach dem Rezept, er sagte: «Das Rezept gebe ich beim ersten Date nicht raus.» Einmal zeigte er mir ein YouTube-Video mit bell hooks, einer Verfechterin feministischer und antirassistischer Ansätze, und ich schlief in der Mitte des Videos ein.
Ein weiteres Jahr später: Wir hatten uns einen Monat nicht gesehen und die Frage stand in der Luft: Ist es ein Neuanfang oder ein Ende? Wir liefen durch den sandigen Grunewald, setzten uns auf einen Baumstamm. Ich erzählte ihm von meinen Überlegungen, einen Film über Rassismus und Privilegien zu machen. Ich war, um ehrlich zu sein, stolz darauf. Ich erzählte voller Elan. Endlich konnte ich zeigen, dass ich ein Verbündeter bin. Das war wohl zu viel. Später, als wir zur S-Bahn-Station zurückliefen und es klar war, dass unsere Beziehung die Endstation erreicht hatte, fragte ich ihn, ob ich ihn noch kontaktieren dürfte, wenn ich etwas von ihm bräuchte. Er sagte, dass er kulturelle Korrektheits-Checks nicht unbezahlt machen würde. Seine Worte brannten sich in mein Gedächtnis und mein fragiles Gefühl von Vertrauen, das ich über das Jahr hinweg aufgebaut hatte, kollabierte in sich zusammen. War ich verletzend, ohne es zu merken? War ich unsensibel? War ich r a s s i s t i s c h?
Ich drehte mich ein paar Monate in einem Kreis aus Scham, Schuldgefühlen, Abwehrhaltung, Selbstablehnung, Trotz und Angst. Ich sah mich als weisses Monster. Vielleicht wäre es besser, in meiner privilegierten Blase zu bleiben, sagte ich mir.
In dieser Zeit las ich bell hooks‘ Where we stand: CLASS MATTERS. Es half mir, die Wichtigkeit des Klassenkampfes wiederzuerkennen. Doch es schürte auch meine Wut. bell hooks sprach von «den Reichen» als Menschen, die nur für die Vermehrung ihrer Klassenprivilegien einstünden. Als ein Kind der oberen Mittelschicht verletzte mich das. Ich verspürte die Verlockung, bell hooks von einer gedanklichen Klippe zu stossen. «So», sagte ich mir, «gewinnt ihr mich nicht.»
Zum Glück stolperte ich irgendwann über ein Zitat, das ebenfalls von bell hooks stammte:
«If we discover in ourselves self-hatred, low self-esteem, or internalized white supremacist thinking and we face it, we can begin to heal. Acknowledging the truth of our reality, both individual and collective, is a necessary stage for personal and political growth. This is usually the most painful stage in the process of learning to love—the one many of us seek to avoid.»
Meine schlechten Gefühle ebbten ab. Ich fand mich im ersten Satz und wusste, dass der zweite Satz mein Ziel war. Doch was bedeutet es genau, «die Wahrheit unserer Realität anzuerkennen»? Ich deutete es als die Erkennung von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und meiner Rolle in ihnen. Um meine Rolle zu klären, begann ich damit, eine Liste zu schreiben. Ich nannte sie «Meine Privilegien».
Meine Privilegien
– Ich bin weiss
– Ich kann als Mann durchgehen
– Ich durfte als Kind Klavier spielen und Sportclubs besuchen
– Meine Eltern unterstützen mich noch immer finanziell
– Ich kann diese Worte in einen schicken Laptop tippen, mein Po auf einem ergonomischen Bürostuhl gebettet
Diese Liste war natürlich noch viel länger. Wie ein Mantra las ich sie mir durch, woraufhin ich mich sofort so fühlte, als ob ich das Leben nicht verdient hatte. Ich machte eine zweite Liste.
Gesellschaftliche Ungerechtigkeiten:
– Schweizer*innen können ohne Visum in 190 Länder reisen, für Afghan*innen sind es 28
– Für Schweizer*innen ist es möglich zu studieren, während geflüchteten Menschen dieser Weg schwer gemacht wird
– Frauen erhalten für die gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer
– Menschen mit gutverdienenden Eltern werden mehr gefördert und haben später mehr Chancen auf gutbezahlte Jobs
– …
Diese Liste gab mir tatsächlich ein besseres Gefühl. Ich sagte mir: Nicht ich bin das Problem, sondern die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und die Strukturen, welche sie bestehen lassen oder fördern.
Die Erkenntnis der eigenen Privilegien geht oft mit Scham einher. Aber auch das Fehlen. So beschreibt bell hooks, die 1952 in eine Arbeiterinnenfamilie geboren wurde: «At times I felt class shame. Often, that shame arose around food—when I did not know what certain foods were that everyone else was familiar with.» bell hooks erläutert eindrücklich, dass Geld und Status die eigene Position am «fancy College» bestimmten und schreibt über ihre Erfahrungen mit Neugier, Spott und Verachtung als weniger privilegierte Person. Ihre Mitschüler*innen und später Mitstudierenden waren mehrheitlich Kinder von Eltern mit akademischem Werdegang. Als Teil der Mehrheit formten sie die Norm und schienen kein Bewusstsein für ihre eigene Privilegiertheit zu haben. Doch es gibt Anzeichen, dass sich dies ändert.
Spätsommer 2023: Der König von Banum aus Kamerun betritt das ethnologische Museum in Berlin und setzt sich auf das Herzstück der Sammlung. Es ist der Thron, der seinen Vorfahren gehörte und von einem Kolonialgouverneur nach Deutschland gebracht wurde. Diese vehemente Forderung nach Gerechtigkeit ist eine von vielen: Im gleichen Jahr demonstrierten Nigerianer*innen vor der französischen Botschaft und die damals neue Militärregierung verwies den Botschafter des Landes.
Zeitgleich entsteht auch in Deutschland ein Bewusstsein über Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. 2022 wurde in Deutschland erstmals eine Antirassismus-Beauftragte ernannt: Reem Alabali-Radovan. Die Bekämpfung von Rassismus stehe oben auf der Agenda der Bundesregierung, steht im Lagebericht zu Rassismus in Deutschland 2023. Zugespitzt schreibt Mohamed Amjahid: «Es gilt mittlerweile auch in Deutschland als cool und woke, rassistische Strukturen (die am besten weit, weit weg sind) anzuerkennen.»
Doch unter dieser oberflächlichen Anerkennung von Rassismus schlummert eine Zerbrechlichkeit: «White fragility» beschreibt das Phänomen, dass sich Menschen oft defensiv verhalten, wenn sie mit ihrem rassistischen Verhalten konfrontiert werden. Auch Tupoka Ogette schreibt – 50 Jahre nachdem bell hooks ihre Erfahrungen mit Klassenscham gemacht hatte – über die Scham von weissen Menschen. Sie definiert sie als eine Phase während der persönlichen Auseinandersetzung mit Rassismus. Die Phasen beinhalten «Happy Land» (siehe oben), Abwehr, Scham, Schuld und Anerkennung, würden aber nicht zwangsläufig in chronologischer aufeinanderfolgen.
Die Scham entsteht, weil die strukturelle Ungerechtigkeit auf die eigenen Privilegien zurückgeführt werden. Diejenigen, die sich nicht davon überzeugen können, dass ihre Vorteile gerechtfertigt sind, geraten in einen ständigen Konflikt, schreiben Montada et al in einem Paper: «Either they give up their advantage or they violate their personal norms of justice.» Entweder, sie geben ihren Vorteil auf oder sie verletzen ihre persönlichen Gerechtigkeitsnormen. Eine mögliche Konsequenz sei die Entwicklung einer Neurose.
Das Denken anzupassen ist natürlich auch möglich. Um mit gutem Gewissen an den «unverdienten Vorteilen» festzuhalten, kehren manche Menschen in die alte, heile Welt zurück. Janet Helms, eine Psychologin und Autorin, beschreibt dies in ihrem Modell zum Selbsterkenntnis-Prozess von weissen Menschen. Die «Abkehr vom Rassismus» beginnt mit dem Wunsch, nicht rassistisch zu sein, aber rassistische Verhaltensmuster an sich zu erkennen (z.B. instinktives Festhalten der Handtasche, wenn sich eine schwarze Person ins gleiche Zugabteil setzt) und darauf aufmerksam gemacht zu werden, ist unangenehm. Nun suchen sie (erstmal) Zuflucht bei ihrer eigenen Gruppe und den vertrauten Ideologien. Es entsteht Wut gegenüber BIPOCs1. Anstatt sich zu öffnen, verhärten sich die Menschen.
Der Übergang zur nächsten Phase ist schwierig, so Helms, und wird oft durch ein prägendes Erlebnis eingeläutet. Menschen beginnen, sich mit weissen Privilegien, der Bedeutung von Rasse als soziales Konstrukt und den Konsequenzen von Vorurteilen zu befassen. Doch noch bleibt diese Auseinandersetzung eine intellektuelle Übung.
2: Gerechtigkeit? Theoretisch Ja…
Annähernd obsessiv stürzte ich mich in eine Internetrecherche zu Privilegien. Auf Buzzfeed fand ich eine Checkliste mit dem Namen «How Privileged Are You?». Sie hatte sagenhafte 4126 Kommentare. Hier ein paar Ausschnitte:
– «…It’s like, sometimes it becomes a contest to be the least privileged, because the less privileged you are, the more qualified you feel to have problems.» (141 Likes)
– I don’t think «privilege» can be measured because its value differs from person to person. (…) (183 Likes)
– Repeat after me: There are white people in the world who are struggling. But those people are not struggling because of their race. (919 Likes)
Die Kommentator*innen gehören meist einer von zwei Kategorien an: diejenigen, die abwehrend reagierten und diejenigen, die darauf antworteten.
Diese Reaktionen spiegelten auch meinen eigenen Prozess wider: Anfangs war ich den Abwehrer*innen sehr dankbar, aber zunehmend betrachte ich die Liste gelassen. Je mehr ich mich mit den Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft beschäftigte, desto weniger kreiste ich um meine eigenen Privilegien. Ich suchte zunehmend weniger danach, Frieden mit meinen unverdienten Vorteilen zu schliessen und machte mir mehr Gedanken zu den strukturellen Wurzeln des Problems.
An einer dunklen Novembernacht wurde meine sehr theoretische Auseinandersetzung dann plötzlich durch eine Begegnung unterbrochen. Ich sass in einem Asia-Imbiss und mein Tischnachbar regte sich auf, dass ich zu meinen gebratenen Nudeln kein Besteck bekommen hatte. Wir kamen ins Gespräch. Er erklärte mir, dass er sich bei einer Organisation namens No Border Assembly engagierte und lud mich ein.
Durch die No Border Assembly erfuhr ich von verschiedenen Strukturen, die illegalisierten und von Deportation bedrohten Menschen helfen. Eine davon: Soli-Asyl. Du kannst einem Menschen Unterschlupf in deinem Zuhause anbieten und so dessen Abschiebung verhindern (wenn die Person nicht auffindbar ist, kann sie auch nicht abgeschoben werden).
Für mich klang es erstmal nach einer guten Möglichkeit, mein Privileg für etwas Gutes zu nutzen. Natürlich war es auch ein verheissungsvolles Ventil für mein schlechtes Gewissen. Ich lebte in einem linken Wohnprojekt und beim nächsten Plenum setzte ich mich für Soli-Asyl bei uns ein.
Die Reaktionen waren sehr verhalten. Es gäbe keine Kapazität, weder raumtechnisch noch emotional. Es gäbe viele andere Aufgaben und Baustellen im Haus. Was, wenn die Person schwierig ist und Betreuung bräuchte? Ich sagte, ich würde mich drum kümmern.
Ähnlich verhalten reagierten meine Freund*innen und Familie: Sie sagten, ich sei eh schon überdurchschnittlich moralisch, ich sei ein guter Mensch auch wenn ich das nicht mache. Ich solle weniger streng mit mir sein und ich habe das Recht, mich auf meinen eigenen Weg zu konzentrieren (damit meinten sie mein Studium).
Der Kampf um Soli-Asyl wurde zu einem inneren Kampf. Vielleicht hatten sie ja Recht? Immerhin war ich oft überfordert mit meinen eigenen Aufgaben. Und ich kann ja auch durch meine Arbeit, zum Beispiel als Journalist, einen Beitrag leisten.
Auch im Wohnprojekt selber fand ich keine Unterstützung. Die Entscheidung wurde auf ein späteres Datum verlegt. Erstmal Haus umbauen. Als ich März 2024 aus dem Wohnprojekt auszog, war Soli-Asyl in die gedankliche Abstellkammer gewandert.
Wichtig bei der Suche nach Lösungen sind unsere Visionen für die Gesellschaft. Der Autor David Hilfiker schreibt: «Neither modern capitalism nor economic imperative requires that necessities be distributed according to wealth.» Hilfiker, der 1945 geboren wurde und als Arzt tätig war, beschreibt eine Zeit, in der davon ausgegangen wurde, dass ein Arzt den Armen half.
Heute leben wir in einer Zeit, in der wenige Menschen einen Grossteil des Vermögens besitzen und dies vom Grossteil der Gesellschaft hingenommen wird. Die Mehrheit der stimmberechtigten Schweizer hat sich dafür entschieden, dass das Einkommen von Leitungspersonen unbeschränkt hoch sein darf (1:12-Initiative) oder dass Firmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, problematische Geschäfte in anderen Ländern fortführen dürfen (Konzernverantwortungsinitiative).
«It is important for us to understand that we have chosen this», schreibt Hilfiker. Die Lösungen sind simpel: Steuern und Vermögens-Transferprogramme. Das einzige, was es braucht, ist die Entscheidung dazu.
Warum fällt es Menschen so schwer, ihre Privilegien zu teilen oder sie im Sinne von weniger Privilegierten einzusetzen?
Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass sich Menschen, die in der sozialen Klasse höher situiert sind, unethischer verhalten als andere: Sie lügen mehr, fahren halsbrecherischer und schummeln, wenn sie dadurch einen Preis gewinnen können. Andere Studien zeigen, dass Individuen, die Macht erhalten, diese nicht im Sinne der anderen einsetzen. Dabei entscheiden sich Menschen jedoch nicht bewusst für Egoismus. Menschen werden in privilegierte Situationen hineingeboren und entwickeln Denkweisen, um ihre Lebensrealität gegen schlechtes Gewissen zu verteidigen.
So (er)finden privilegierte Menschen nicht nur gute Gründe für ihre privilegierte Situationen, sie vermehren sie auch. Reiche Menschen investieren gewinnbringend, Männer sichern sich Leitungspositionen. So sind Privilegien nicht nur die Konsequenz von ungerechter Verteilung, sie sind auch deren Motor. Doch werden wir zu besseren Menschen, wenn wir unsere Privilegien abtreten?
Bei bestimmten Privilegien – zum Beispiel weissen Privilegien – geht das gar nicht. Ich könnte aber den Grossteil meines Geldes spenden. Heute sogar. Ich könnte, wie bell hooks vorschlägt, ein Leben in Einfachheit führen. Eine Entscheidung wie diese wäre technisch gesehen einfach zu vollziehen: ich müsste mich nur von Dingen trennen.
Das fällt gemäss Erfahrung jedoch schwer, auch wenn ein Mensch eigentlich genug hätte, um zu teilen. Schliesslich hat jede*r ja hart dafür gearbeitet. «Der Gedanke, dass unser Schicksal unsere Verdienste widerspiegelt, ist in der moralischen Institution der westlichen Kultur tief verwurzelt», schreibt Michael Sandel und weist darauf hin: In der Bibel werden sogar Naturkatastrophen wie Dürren und Heuschreckenplagen auf unmoralisches Verhalten zurückgeführt. Anders herum wird Gottvertrauen hoch belohnt. Wir bekommen, was wir uns verdient haben. Und das dürfen wir auch behalten.
Doch der Leistungsgedanke klammert die Existenz von unverdienten Privilegien aus. Tatsächlich starten Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten ins Leben. Salopp gesagt: Mit einem Sprungbrett unter den Füssen lässt es sich höher springen. Das Leistungsdenken verschleiert diese Tatsache. Gedanken über gerechte Umverteilung werden vom Streben nach mehr verdrängt. Und so stellt sich die Frage: Müssen wir den Leistungsgedanken loslassen, um leichter mit Privilegien umgehen zu lernen?
Die gute Nachricht: Den Sog der Leistungsgesellschaft zu erkennen, ist bereits der erste Schritt. Darin liegt eine gewisse Kraft, sich dem Leistungsdenken zu entziehen. Doch es stellt sich eine weitere Frage: Brauchen wir Taten, um unser Denken zu verändern?
3. Ein sinnvoller Umgang mit Privilegien?

Im Internet suchte ich erfolglos nach einem «guten Umgang» mit den eigenen Privilegien. Dafür las und hörte ich immer wieder, dass es wichtig sei, sich den eigenen Privilegien bewusst zu sein. Doch reicht das? Ich denke nicht.
Durch meine Teilnahme an den Plenas der No Border Assembly wurde meine Auseinandersetzung mit Privilegien zunehmend emotional. Dies geschah dadurch, dass ich Menschen kennenlernte mit deutlich weniger Privilegien als ich selbst. Durch Aktivist*innen der No Border Assembly, die sich im Asylprozess befanden, wurden mir meine Privilegien noch einmal schmerzhaft vor Augen geführt. Ich war ein Student ohne Geldsorgen und ich sass im gleichen Raum mit Menschen, die zum Teil mit 0 bis 125 Euro pro Monat auskommen mussten. Als Schweizer hatte ich mich immer gefreut, wie billig ein Döner in Berlin ist. Nun lernte ich Leute kennen, die nie auswärts assen und Pfandflaschen sammelten, um über die Runden zu kommen.
Während ich mich mit den Menschen der No Border Assembly anfreundete, veränderte ich mich. Meine erste Intuition war es, mich mit Menschen in einem Kaffee zu treffen und sie einzuladen. Jedoch merkte ich, dass dies nicht nur ein reiner Akt der Grosszügigkeit war: Ich verharrte dabei auch in meiner Welt und fragte mich später, ob ich sie meinen neuen Freund*innen aufgezwungen hatte. Die Geflüchteten trafen sich nicht in Kaffees, sondern in KüFas (Küche für alle) und an Orten, wo sie sich ohne Konsumzwang aufhalten konnten. Also trafen wir uns dort. Ich entwickelte eine besondere Sensibilität fürs Geld, wurde sparsamer. Manchmal fragte ich mich, ob das heuchlerisch war, aber eine Brücke zwischen unseren Welten zu schlagen, scheint dadurch einfacher.
Doch die Scham gegenüber meinen eigenen Privilegien stand plötzlich im Schatten der Schicksale, mit denen ich konfrontiert war. Das innere Drama, um das ich mich monatelang gedreht hatte, wurde nun überschattet von praktischen Fragen. Es gab einfach viel zu tun. Die geflüchteten Aktivist*innen begannen, mich um organisatorische Hilfe, um Hilfe beim Übersetzen oder um Geld zu fragen.
Anfangs sagte ich oft ja, ohne nachzudenken und sagte dann eine Weile pro forma nein. Insbesondere erkannte ich eine Differenz zwischen dem, was ich geben kann und dem, was ich geben will. Zum Beispiel war es für mich emotional schwierig, hundert Euro locker zu machen für einen Anwalt – auch wenn ich das Geld entbehren konnte. Das war wiederum sehr unangenehm und löste in mir erneut Scham aus.
Ich habe die hundert Euro dann locker gemacht. Es hat sich gut angefühlt. Doch jedes Mal ist es ein neues Austarieren von Grenzen, Hemmungen und Scham.
Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass «der sinnvolle Umgang mit Privilegien» aus einer handvoll Weisheiten besteht, die ich finden und in einem Artikel festhalten kann. Zumindest nicht als allgemeine Regel. Genauso wenig wurde der Umgang mit Privilegien für mich zu einer Praxis, die mir leichter und leichter fällt.
So geht meine Auseinandersetzung mit Privilegien weiter. Ich sehe sie nun klarer, doch ist der Umgang mit ihnen wohl etwas, das Zeit und Übung braucht. Und viel Ehrlichkeit. Doch zumindest eine Sache scheint doch etwas klarer: Je mehr es um das Lösen von praktischen Problemen geht, das Bekämpfen von Ungerechtigkeiten oder die Unterstützung von Menschen, desto weniger dreht sich der Kopf um die eigenen Privilegien. Ich versuche, mehr über Kapazitäten und Ressourcen nachzudenken. Ich frage mich, wo meine persönliche Grenzen wirklich sind (und wie ich reiche Verwandte überzeugen kann, ihr Geld zu spenden).
Um ein paar konkrete Lösungen zu finden, habe ich drei unterschiedliche Menschen gefragt, wie Berner Studierende besser mit ihren Privilegien umgehen können.
Die erste Person, die antwortete, war Maria-Cecilia Quadri, Co-Geschäftsführerin vom Institut Neue Schweiz (INES). Sie schrieb, dass sie mir kein Patentrezept zum Umgang mit Privilegien geben kann. Es gibt kein eindeutiges Verständnis darüber, was Privilegien sind, und auch nicht, inwiefern die Betonung derPrivilegien produktiv ist. «Wenn eine Person Wahl- und Stimmrecht hat, während eine andere es nicht hat, ist dies ein Recht, ein Privileg oder eine Diskriminierung? Und was mache ich damit? Nutze ich dieses Recht und gehe immer – wenn ich kann – wählen?»
Die zweite Person, die mir antwortete, war Gina Vega, Leiterin der Fachstelle Diskriminierung und Rassismus bei humanrights.ch: «Wichtig ist, dass man nicht in Schuldgefühle, Scham und Abwehr verfällt, sondern den Status Quo reflektiert und hinterfragt. Wir alle müssen lernen, bewusst mit den eigenen Möglichkeiten umzugehen, um uns für Gerechtigkeit einzusetzen und Veränderungen aus unseren eigenen Privilegien und Positionierungen zu ermöglichen.» Dafür, so Gina Vega, müssen wir uns weiterbilden, unser Wissen über verschiedene Diskriminierungsformen und über Rassismus aufbauen, Betroffenen zuhören und zivilcouragiert agieren.
Im Bezug auf ökonomische Privilegien habe ich mit Johann (Name geändert) von taxmenow gesprochen. Wenn ich so viel Geld habe, dass es mir ein schlechtes Gewissen macht, kann ich:
Mich bei taxmenow für die verstärkte Besteuerung von wohlhabenden Menschen einsetzen
Mein Geld spenden
(Ja, es ist so simpel. Aber wahr.)
Zum Abschluss fragte ich meine Redaktion, was sie für Einsatzmöglichkeiten für privilegierte Studierende sieht. Folgende Empfehlungen kamen zustande. Du kannst…
…dich ab dem 1. Juni für den Offenen Hörsaal anmelden. Dadurch wirst du Mentorin für geflüchtete Personen an der Uni Bern.
…für deine Mitstudierende da sein, wenn sie dich brauchen – mit den Ressourcen, die du hast.
…dich politisch engagieren (beispielsweise im Studierendenrat).
…deine Stimme, die an manchen Orten (zum Beispiel unter privilegierten Menschen) mehr Gehör findet, erheben und dich so für eine gerechtere Verteilung einsetzen.
text & illustration: florian rudolph
- 1BIPoC steht für «Black, Indigenous, and people of color». ↩︎