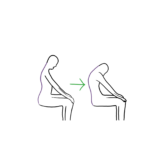Qualität vor Quadratmeter

Ein Mensch in der Schweiz bewohnt im Durchschnitt 46 m2 und besitzt mehr Dinge, als in einen Kofferraum passen. Die bärner studizytig stellt vier Wohnformen vor, die anders sind.
Ein buntes Holzschild an der Bushaltestelle im luzernischen Luthern Bad weist den Weg hinauf zu einem einzigartigen Dorf. Hier, am Fusse des Napfs, stehen auf einer abfallenden Wiese am Waldrand rund 20 Jurten, jede davon auf einer Holzplattform. Dazwischen schlängeln sich Kieswege, auf denen Hühner umherwandern. Zu den Gemüsebeeten und hinunter zur Saunajurte am Bach führt ein Grasweg. Und über allem erhebt sich das umgebaute Bauernhaus. In der offenen Küche mit Sicht auf die weissen Jurten steht Andrea und vakuumiert Blumenkohl. Sie ist Gründerin des Jurtendorfs und lebt zusammen mit ihrem Mann Thömu in einer der Jurten.
«Manchmal halte ich es für selbstverständlich, hier zu stehen. In unserer Küche mit dem Pflastersteinboden, den vielen Regalen und dem Holzherd in der Mitte», sagt die 49-Jährige. «Doch dann kommt mir in den Sinn, dass wir das alles in den letzten zehn Jahren selbst gebaut haben.» So lange ist es her, seit der Kanton dem Jurtendorf eine dauerhafte Bewilligung erteilte – obwohl hier eine Landwirtschaftszone ist. «Vor 2011 konnten wir die Jurten nur während den Sommermonaten aufstellen. Deshalb hatten wir nur fünf oder sechs davon», erklärt Andrea. Sie deutet auf das Fotoalbum, das diese Anfangsphase dokumentiert. Erst nach Erhalt der Sonderbewilligung konnte sie zusammen mit vielen Helfer*innen damit beginnen, das Gelände zu gestalten.
Ein Lebenswerk entsteht
Auf die Jurte als Wohnform stiess die ehemalige Primarlehrerin durch einen Zufall: Eigentlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, in Frankreich ein Ruinendorf zu beleben, sah sie im Garten von Bekannten das erste Mal eine Jurte. Das war vor über 20 Jahren. Andrea war sofort begeistert: «Im runden Raum fühlt man sich umarmt, geborgen. Schliesslich ist auch in der Natur vieles rund». So entschloss sie sich, in der Schweiz ebenfalls eine Jurte zu bauen und darin zu wohnen. Anfangs alleine an einem Waldrand, dann mit einer Kollegin, und seit 2011 schliesslich hier in Luthern Bad. Letzten Winter wohnte sie mit Thömu versuchsweise in der neuen Dachwohnung des Bauernhauses. Diese ist luftig gebaut, mit grossen Fenstern und schrägen Balken. Dennoch sei es seltsam gewesen, so wenig von der Aussenwelt mitzubekommen, findet Andrea.

Das Jurtendorf ist das Lebenswerk von Andrea. Eine der rund 20 Jurten dient als Gemeinschaftsraum und Esssaal für die bis zu 70 Sommergäste.
In der Jurte sei das ganz anders: «Ich höre den Regen, den Wind, die Leute rundherum.» In der Stadt wohnen möchte sie auf keinen Fall. «Dort wäre es mir viel zu eng. Und es hat viel zu viel Beton». Dieses Gefühl, im Jurtendorf eng mit der Natur verbunden zu sein, möchte sie auch anderen Menschen ermöglichen. So kommen zu den neun Leuten, die momentan im Jurtendorf wohnen, zu Spitzenzeiten bis zu 70 Gäste dazu. Sie reisen für Seminare, Ferienlager oder auch Hochzeiten an. Damit, und mit dem Bau und dem Verkauf von Jurten, finanziert sich das Dorf.
Das Herzblut, das darin steckt, sieht man an der künstlerischen und aufwändigen Gestaltung der Jurten. Und an der Zufriedenheit, die Andrea ausstrahlt. «Ich bin enorm dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, so etwas wie das Jurtendorf aufzubauen», erzählt sie beim Bohnenabpacken. «Ich denke, viele Menschen sehnen sich nach dem Gefühl, das ich habe. Diese Gewissheit, dass mein Leben hier genau das ist, was ich will.» Die Reduktion auf das Notwendigste, da in der Jurte nur wenig Platz ist, trage sicher dazu bei. «Allerdings besitze ich mittlerweile ja ein ganzes Jurtendorf. Das ist nicht wenig», gesteht sie ein. Weitere Jurten hinzustellen plant sie vorerst nicht. Einzig den Gemüsegarten möchte sie noch weiter ausbauen. Doch vorerst ist es Zeit, zwei neue Gäste willkommen zu heissen, die soeben den Weg ins Jurtendorf gefunden haben und staunend umherblicken.
«Ich denke, viele Menschen sehnen sich nach dem Gefühl, das ich im Jurtendorf habe. Diese Gewissheit, dass mein Leben hier genau das ist, was ich will.»
Eine rechtliche Ausnahme
Dass es so lange dauert, bis ein alternatives Wohnprojekt bewilligt wird, sei leider normal, sagt Miriam Kost. Sie ist Geschäftsleiterin vom Verein Kleinwohnformen Schweiz. Momentan gelten für alle Kleinwohnformen – ob Tiny House, Jurte oder Zirkuswagen – nämlich genau die gleichen Regeln wie für ein Einfamilienhaus. Dabei wollen sich die Kleinwohnformen eigentlich bewusst vom Durchschnitt abheben. Beispielsweise indem sie mit maximal 40 m2 Wohnfläche auskommen. Doch im Baurecht seien diese Wohnformen noch nicht berücksichtigt. Der im Jahr 2018 gegründete Verein will das ändern. So soll sich eine Gemeinde dank dem geplanten Leitfaden des Vereins nicht von den Eigenheiten einer Kleinwohnform abschrecken lassen. Davon würde auch die Gemeinde profitieren, ist der Verein überzeugt. Als Vorteil nennt er die zusätzlichen Steuerzahlenden, aber auch die mediale Aufmerksamkeit, die ein solches Projekt mit sich bringt.
Bis das Baurecht angepasst werde, brauche es noch viel Aufklärarbeit und politischen Druck. Das steht für Vereinsfrau Miriam Kost fest. In der Zwischenzeit komme es relativ häufig vor, dass eine Gemeinde trotz fehlender Bewilligung ein Auge zudrücke. Doch das Risiko bleibt: Die Bewohner*innen könnten jederzeit weggeschickt werden. Der Verein setzt sich derweilen ausschliesslich für Wohnprojekte in der Bauzone ein. Auch Wasser- und Sanitäranschluss sind zwingend. Zudem darf eine Behausung nach Ansicht des Vereins den Boden nicht versiegeln. Stattdessen muss sie auf Rädern, oder – wie die Jurten – auf Punktfundamenten stehen. «Wir wollen nicht zur Zersiedelung beitragen, sondern zur Verdichtung. Deshalb unterstützen wir nicht jede Form von kleinen Häusern», begründet Miriam Kost die enggefasste Definition.
Wohnen auf Zeit
Anstelle einer dauerhaften Baubewilligung besteht auch die Möglichkeit eines Zwischennutzungsvertrags. Einen solchen hat das Kollektiv Anstadt mit der Stadt Bern abgeschlossen. Angefangen hat die Zwischennutzung der Wiese neben dem Berner Gaskessel im Sommer 2018. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe besetzte das brachliegende Areal und verwandelte es in ein alternatives, antikapitalistisches und gemeinschaftliches Stadtexperiment. In dieser Anfangszeit wohnten die Besetzer*innen in einem alten Feuerwehrauto, einem Boot und einigen Zelten. «Damals war unser Fokus aber gar nicht das Wohnen. Wir wollten einfach einen Platz kreativ nutzen und nach anderen Idealen leben», erklärt Joscha. Der 28-jährige Sozialpädagoge war von Anfang an überzeugt von der Philosophie der Anstadt.

Joscha geniesst die Mittagssonne vor seinem selbstgebauten Haus in der Anstadt in Bern.
Auch heute dient die Anstadt nur zur Hälfte als Wohnraum – meistens in Form von selbstgebauten Holzhäusern. Die andere Hälfte ist für die zahlreichen Projekte reserviert. In diesem öffentlich zugänglichen Bereich hat es unter anderem einen Boulderblock, einen Spielplatz, einen Garten und einen Pizzaofen. Es soll ein Ort für Kreativität, Gestaltung und Begegnung sein. Vor kurzem baute Joscha mit anderen ausserdem einen Tanz- und Bewegungsraum. Auch hier widerspiegelt sich der Grundgedanke der Anstadt, anders zu sein als der Rest der Stadt: Bei der Benützung des Tanzraumes ist es explizit verboten, einen kommerziellen Gewinn zu erzielen.
Den ersten Anstadt-Sommer hatte Joscha im Zelt verbracht. Danach, im Herbst 2018, entschloss er sich, zusammen mit drei Freund*innen ein Haus zu bauen. Im darauffolgenden Frühling begannen die Planung und Skizzierung der neuen Heimat. Dass eine Architektin unter ihnen war, habe enorm geholfen, erinnert sich Joscha. «Wir mussten leider die Idee, ganz ohne rechte Winkel auszukommen, aus praktischen Gründen wieder verwerfen. Aber uns war dennoch wichtig, kein 08/15-Haus zu bauen.» Schliesslich entschlossen sich die vier für ein grosses, nach Süden ausgerichtetes Wohnzimmer und L-förmige Schlafzimmer, die wie Puzzleteile ineinanderpassen. So befindet sich das Bett des hinteren Schlafzimmers erhöht über dem Kleiderschrank des zweiten Schlafzimmers nebenan.
In jedem Winkel ist die Einzigartigkeit des 2-stöckigen Hauses erkennbar. Die Duschwand etwa ist mit einem kunstvollen und farbenfrohen Mosaik verziert, und in der Duschdecke erinnert eine eingebaute Lichterkette an den Sternenhimmel. Derweilen hängt am Hauptbalken im Wohnzimmer ein Kleber mit dem Wort «stabiu». Joscha erklärt: «Wir waren uns nicht sicher, ob der Balken hält. Vor allem, wenn im Winter Schnee auf dem Dach liegt.» Ein Fachmann habe ihn aber später als sicher eingestuft.
«Am Anfang war unser Fokus gar nicht das Wohnen. Wir wollten einfach einen Platz kreativ nutzen und nach anderen Idealen leben.»
YouTube sei dank
Ohne entsprechende Ausbildung ein Haus zu bauen sei durchaus eine verrückte Idee gewesen, gesteht Joscha ein. Bei vielen kleineren Arbeiten hätten sie YouTube-Tutorials genutzt, sagt er grinsend. Als Verantwortlicher für die Installation der Wasserleitungen und der Zentralheizung musste er sich dennoch an einen ausgebildeten Heizungsinstallateur wenden. «Das Ganze war so kompliziert, dass ich froh war, konnte ich ihm Fotos schicken und fragen, ob meine Idee funktioniert oder ob dann gleich alles explodiert.»
Erst seit etwa einem Jahr sei das Haus einigermassen fertig. «Wenn ich aber merke, dass etwas noch fehlt, baue ich es einfach. Das wird wohl noch eine Weile so weitergehen.» Zumindest bis zu dem Tag, an dem die Anwohner*innen der Anstadt das Gelände verlassen müssen. Wann das sein wird, weiss niemand genau. Die Stadt Bern hat jedoch einen Architekturwettbewerb für die Überbauung des gesamten Areals lanciert. Das sei sehr schade, findet Joscha. «Denn leider gibt es kaum mehr solche Räume wie die Anstadt. Räume, die anders funktionieren und bei dem deine inneren sowie äusseren Merkmale kein Grund für Diskriminierung sind.»
Weil die vier Freund*innen bereits wussten, dass sie ihr zukünftiges Haus nur für eine begrenzte Dauer bewohnen würden, wollten sie möglichst wenig Material neu anschaffen. Auch hätten sie gar nicht das Geld gehabt, um alles neu zu kaufen. «Unser bester Materialliferant war Tutti. Wir waren alle eine Weile lang Tutti-süchtig». Ein Grossteil des Baumaterials stammt ausserdem von einer alten Baracke in Thun, die sie eigenhändig abgebaut haben. Und ein Unternehmer schenkte ihnen Rohre und Leitungen, bevor er nach seiner Pensionierung sein Geschäft auflöste. So bestehe das Haus aus rund 90% recyceltem Material und ist Joscha zufolge so gut isoliert, dass es fast Minergie-Standards entspricht. «Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, ohne Beton und mit sehr wenig finanziellen Mitteln ein Haus zu bauen, das den modernsten Energiestandards entspricht.» Das sei ihnen gelungen. Egal wie es mit der Anstadt weitergehe.
«Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, ohne Beton und mit sehr wenig finanziellen Mitteln ein Haus zu bauen, das den modernsten Energiestandards entspricht.»
Geburt eines Tiny House
Einen anderen Weg, mit möglichst wenig auszukommen, haben Johannes und Philip gefunden. Ihr Projekt minim2 hat das Ziel, auf kleinstmöglichem Raum einen maximalen Wohnkomfort zu ermöglichen. Ursprünglich war ihre Idee nur, ein möglichst kosteneffizientes Haus zu bauen. Bei einem Feierabendbier überlegten der Architekt und der Möbelschreiner, wieso das Bauen in der Schweiz so wahnsinnig teuer ist. Sie merkten rasch: Es liegt nicht nur an den hohen Schweizer Löhnen, sondern auch am vielen Material. Da sie den Lohn ihrer Mitarbeitenden nicht antasten wollten, sahen sie die Lösung darin, ein Haus mit möglichst kleiner Fläche und damit möglichst wenig Material zu bauen. Per Zufall suchte ein Ehepaar im solothurnischen Bellach zu genau dieser Zeit nach einer Architektin oder einem Architekten, um ein brachliegendes Grundstück vor ihrem Einfamilienhaus zu bebauen.

Die drei individuellen Module des Tiny House wurden Anfang September in Bellach sorgfältig aufeinander gestellt und verbunden.
Das Resultat der Zusammenarbeit entstand in der Schreinerei von Phillip in Biberist. Das Tiny House verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 38 m2 verteilt auf drei Etagen. Jedes Stockwerk wurde als eigenständiges Modul gebaut, anfangs September nach Bellach transportiert und dort zusammengesetzt. Im Erdgeschoss befindet sich die Küche, im ersten Stock das Bad sowie das Wohnzimmer und in der Galerie im Dachgeschoss das Schlafzimmer. «Es würde auch noch kleiner gehen, unser Tiny House ist jetzt eigentlich die Luxusvariante», meint Philip zur limitierten Wohnfläche. «Aber wir wollten nicht, dass man sich eingeschränkt fühlt». Das Haus sei für ein Pärchen ausgelegt. Durch die getrennten Räume könne eine Person noch im Wohnzimmer arbeiten, während die andere bereits schlafen geht. Bei noch kleineren Varianten müsste hingegen das Bett hochgeklappt werden, um am Tisch sitzen zu können. Das würde den Wohnkomfort zu stark einschränken, fanden die beiden Freunde.
Ein Haus bauen als Konsumkritik
«Die grösste Herausforderung war, das Gewicht der drei Module möglichst klein zu halten», erklärt Philip. Die Module mussten nämlich mit dem Kran auf Lastwagen gehoben und von Biberist nach Bellach transportiert werden. Auch sei es schwierig gewesen, ausnahmsweise alles selbst zu organisieren: von der Planung und dem Bauen bis hin zum Transport und der Organisation mit den verschiedenen Gewerkschaften, der Polizei und der Gemeinde. Dabei funktionierte die Zusammenarbeit erstaunlich gut: «Ob Behörden oder Private, allen gefiel unser Projekt und haben uns dementsprechend unterstützt». Passant*innen seien skeptischer, erzählt Philip. Sobald man mit ihnen spreche, merke man aber, dass ein Umdenken stattfindet: «Sie sagen dann, dass sie gar nicht allen Platz in ihrem Einfamilienhaus benötigen, oder beklagen sich über die Unordnung zuhause.» Wenn man aber gar keinen Keller habe, überlege man sich bereits bei der Anschaffung, ob man das neue Teil tatsächlich braucht.
Die Idee hinter dem Tiny House sei deshalb, wegzukommen von der Konsumgesellschaft und dem Besitzeifer, der viele erfasst habe. «Bist du wirklich glücklicher, wenn dein Haus fünfmal so gross ist?», fragt Philip und fährt fort: «Die Generation unserer Eltern war noch weniger sensibilisiert für Umweltthemen – anders als wir heute. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann und fragen uns, was wir den Generationen nach uns hinterlassen.»
«Bist du wirklich glücklicher, wenn dein Haus fünfmal so gross ist?»
Konkrete Zukunftspläne für weitere Tiny House-Projekte haben die beiden noch nicht, auch wenn sie genügend Interessent*innen hätten. Viele wollen zunächst jedoch anhand des Prototyps erfahren, wie sich das Leben in so einem Tiny House anfühlt. Und die beiden Erbauer? Plant einer von ihnen den Einzug ins Mini-Gebäude? «Nein, die ganzen Spielzeuge von meinem Sohn hätten nie Platz», sagt Philip und lacht. Wenn die Kinder mal erwachsen und ausgezogen seien, könnten es sich Johannes und Philip aber durchaus vorstellen. Auch der Eigentümer und die Eigentümerin des Prototypen wollen erst einziehen, wenn sie in Rente sind. Aus diesem Grund wird das Tiny House zunächst für ein paar Jahre vermietet.

Hier hing die Treppe noch im leeren Raum, jetzt verbindet sie die einzelnen Wohnräume der drei Stockwerke miteinander.
Wohnen auf vier Rädern
Nicht alle sind davon überzeugt, dass sich ein Tiny House finanziell lohnt. Bastian beispielsweise würde zwar gerne mal in einem solchen Haus wohnen. Doch der 34-jährige Berner hält es momentan nicht für realistisch. «Auf Dauer ist es sehr teuer, in einem Tiny House zu wohnen», sagt er. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Eigenheim erhalte man für ein Tiny House nämlich kein Bankdarlehen. Er hat deshalb stattdessen den Versuch gestartet, seinen Wohnsitz auf vier Räder zu verlegen.
Seit März lebt er in seinem umgebauten Van und reist damit kreuz und quer durch die Schweiz. An einem Ort ist er stets nur für eine Nacht. Wo das jeweils ist, hält er am liebsten geheim. Denn gerade im Kanton Bern verschwinden ihm zufolge zunehmend die Plätze, wo campieren für eine Nacht erlaubt ist – zu viele Leute hätten seit der Pandemie diese Freiheit für sich entdeckt. Auch Bastian war letztes Jahr schon tage- oder wochenweise im Van unterwegs. Dass seine WG in Zürich im Frühling aufgelöst wurde, nutzt er nun als Chance, Vollzeit im Auto zu wohnen. «Ich betrachte es als Experiment. Ich will herausfinden, wie viel es braucht, um so zu leben. Wäre das längerfristig etwas für mich? Und wie nachhaltig ist es überhaupt?».
Am Anfang sei es stressig gewesen, nicht zu wissen, wo er am Abend schlafen würde, blickt Bastian zurück. «Und ich hatte damals noch keine Standheizung, so war es manchmal echt kalt!». Mittlerweile nimmt es der Informatiker gelassener. Er hat ein Gefühl dafür entwickelt, wo er einen guten Übernachtungsplatz finden kann. Ab und zu tarnt er den Van gar als Baustellenfahrzeug: «Ich lege eine Leuchtweste und meinen Kletterhelm aufs Armaturenbrett, dann falle ich niemandem auf», sagt er und lacht.
«In der Schweiz gehört jeder Flecken irgendjemandem.»
Auch Bastian empfindet es als grossen Vorteil, selbst über die Ausstattung und Ausgestaltung seines Zuhauses zu bestimmen. So hat er in den letzten Monaten den Innenausbau optimiert, unter anderem mit einer Komposttoilette. Auch eine Kochnische und einen Kühlschrank besitzt er. Letzterer steht auf Rollen unter dem schmalen Bett. So wird praktisch jeder Zentimeter im Van sinnvoll genutzt. Diese Reduktion des Besitzes sieht er als klaren Vorteil seines Lebensstils: «Ich trage jetzt nur noch meine Lieblings-Shirts», stellt er verschmitzt fest. Und dass er am Feierabend direkt hinaus in die Natur treten könne, sei schlicht genial. Allerdings sei es durchaus aufwändig, seine fahrbare Wohnung instand zu halten. Damit verweist er auf die Notwendigkeit, stets genügend Wasser im Tank zu haben, seine 12 Volt-Batterie mittels Solarpanel auf dem Autodach zu laden und vor schlechtem Wetter Schutz zu suchen. «Du suchst ein einfaches Leben, verbringst dabei aber auch viel Zeit damit, das Leben einfach zu halten», fasst er zusammen. So geniesst er es, zwischendurch bei seiner Freundin in Bern oder bei Bekannten irgendwo in der Schweiz übernachten zu können.
Ab Oktober hat Bastian sogar wieder eine Wohnung in Zürich. Er freue sich darauf, mit mehr als einer Pfanne kochen zu können. Und sein Experiment sei trotzdem gelungen, findet er: «Es ist eine super Erfahrung, zu merken, mit wie wenig ich auskomme. Meine restlichen Sachen, die bei einem Freund im Keller stehen, vermisse ich überhaupt nicht.» Auch sei er erstaunt darüber, mit wie wenig Strom, Gas und Diesel er auskomme. Damit wehrt er sich gegen den häufigen Vorwurf, mit dem Van herumzufahren sei ökologisch verwerflich. Was er mit dem Van macht, wenn er wieder in einer festen Wohnung lebt, weiss er noch nicht. «Ich denke, ich werde nächstes Jahr wieder mehrere Monate damit herumreisen und die Wohnung währenddessen untervermieten. Denn einen Van und eine Wohnung gleichzeitig zu haben, finde ich nicht vertretbar.»

Wo er nachts parkiert, sagt Bastian grundsätzlich niemandem weiter. Er wolle nicht zum Instagram-Hype beitragen und so riskieren, dass Gemeinden das Campieren zunehmend verbieten.
Nachmachen nur bedingt erwünscht
Können die Wohnformen, von denen Andrea, Joscha, Johannes, Philip und Bastian so schwärmen, als Vorbild für andere dienen? Wären sie dafür geeignet, dem steigenden Bedarf an Wohnfläche pro Person entgegenzuwirken und stattdessen nachhaltigere Behausungen voranzutreiben? Nein, sind sich alle Interviewten einig. So stellt etwa Bastian fest: «Im Van zu wohnen funktioniert nur, weil es nicht alle machen». Und auch Miriam Kost vom Verein für Kleinwohnformen betont: «Wenn alle in einem Tiny House leben würden, hätten wir zu wenig Platz». Denn naturgemäss gehen solche Bauten kaum in die Höhe. Es sei aber auch gar nicht das Ziel, dass es nur noch Kleinwohnformen gebe, sagt Kost. Ihr Potential bestehe vor allem darin, bestehende Wohnformen zu ergänzen. Etwa indem im Garten eines Einfamilienhauses nachträglich ein Tiny House hingestellt wird. Dort könnten – wie früher im «Stöckli» – beispielsweise die Grosseltern einziehen.
Die Zukunft von Kleinwohnformen in der Schweiz ist auch abhängig vom Interesse der Mehrheitsgesellschaft und damit der Politik, solche alternativen Formen zu fördern. Im Kanton Bern nahm der Grosse Rat im Herbst 2020 ein entsprechendes Postulat an, das nun vom Regierungsrat geprüft wird. Mit dem Vorstoss sollen Kleinwohnformen zukünftig als Instrument der Siedlungsentwicklung genutzt werden. Auf Bundesebene existiert bisher kein vergleichbarer Vorstoss. Immerhin läuft bis 2023 ein Forschungsprogramm, das unter anderem eine Anpassung der Wohnungspolitik an veränderte Wohnbedürfnisse thematisiert. So hängt die Umsetzung solcher Wohnformen vorerst stark vom Goodwill der jeweiligen Gemeinde ab. Andrea etwa betonte, wie entscheidend es war, die Gemeinde Luthern Bad von den Vorteilen des Jurtendorfs zu überzeugen. In ihrem Fall habe das geklappt. An den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen etwas grundlegend zu ändern, hält sie hingegen für schwierig: «Wegen der fehlenden Hypothek und dem minimalisierten Besitz lässt sich an uns wenig Geld verdienen.»
Erschwerend kommt hinzu, wie stark das Privateigentum in der Schweiz geschützt ist. Oder wie Bastian es formuliert: «In der Schweiz gehört jeder Flecken irgendjemandem». Mit dieser Begründung lehnte der Bundesrat 2018 eine Motion von SP-Nationalrat Fabian Molina ab, die unbürokratische Zwischennutzungen von ungenutzten Grundstücken ermöglichen wollte. Der Bundesrat erachtete den Vorschlag als nicht vereinbar mit den bestehenden Eigentumsgesetzen und verwies auf die Möglichkeit, individuelle Abmachungen mit den Besitzer*innen eines Grundstücks zu treffen.
Minimalismus als Gewinn
Obwohl sie ein Nischenphänomen bleiben dürften, könnten die vier porträtierten Wohnformen dennoch zu einem Umdenken beitragen: Einem Umdenken, was den Bedarf an materiellen Gütern betrifft. So wünscht sich beispielsweise Andrea, dass ihr Jurtendorf Menschen dabei hilft, mit weniger zufrieden zu sein. Denn wer sich der Natur näher fühle, habe automatisch weniger Bedürfnisse nach materiellem Besitz, ist sie überzeugt.
Auch Philip und Johannes hoffen, dass in der Gesellschaft mehr darüber diskutiert wird, wie viel es zum Wohnen wirklich braucht. Der Pioniergeist von Andrea, Joscha, Johannes, Philip und Bastian hilft also nicht nur ihrem persönlichen Projekt- oder Wohnglück, sondern regt an zum Nachdenken darüber, wie wir wohnen wollen. Egal ob es darum geht, Minimalismus als Lebensform auszutesten, eine Fläche zu beleben oder gleich ein ganzes Lebenswerk aufzubauen: Die Interviewten haben ihre Wohnform bewusst gewählt und zeigen damit: Wie viel wir besitzen und wie wir wohnen ist weder eine Selbstverständlichkeit, noch fehlt es an Alternativen.
Bilder: Bettina Wyler, Lara Schmid, Simon von Gunten