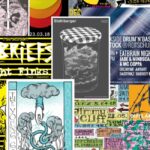«Ich habe weniger Einfluss, als viele denken.»

Foto: Esther Michel.
Alec von Graffenried ist Berns erster grüner Stadtpräsident. Mit der bärner studizytig sprach er über das Studi-Leben in den Achtzigern, die ominöse Burgergemeinde und worüber er sich in der Politik aufregt.
Was bedeutet Bern für Sie?
Alles. Ich bin nie von Bern weggekommen. Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich studiert und hier lebe ich noch immer.
Geboren sind Sie aber in Chur. Was hat sich verändert, seit Sie 1965 als Dreijähriger nach Bern kamen?
Die Stadt ist viel lebendiger als noch zu meiner Jugendzeit. Seit ich Stadtpräsident bin, habe ich noch mehr Kontakt zu den Bernerinnen und Bernern und bekomme mit, was in den Quartieren läuft und wie engagiert die Leute hier sind. Die Lebensqualität hat sich seit meiner Jugend deutlich verbessert.
In den Achtzigern haben sie während acht Jahren an der Universität Bern Jus studiert. Waren die Studentenpartys damals wilder als heute?
Da fehlt mir der Vergleichswert dazu, wie es heute ist (lacht). Ich denke aber, dass heute viel mehr los ist als damals. Wenn wir in den Ausgang wollten, hatten wir viel weniger Möglichkeiten. Die Restaurants schlossen alle bereits um 23.30 Uhr, am Samstag eine Stunde später. Danach bekam man nur noch in der Glocke eine Pizza.
Und in den Clubs?
Auch da war nicht viel los. Die gestylten Discos sagten uns nichts. Sonst gab es einmal im Monat ein teures Konzert im Bierhübeli oder das ISC, wo ein- bis zweimal im Monat etwas lief. In den Achtzigern kam dann die Reitschule mit vielen illegalen Partys und Bars, die meist kurzfristig organisiert wurden. Heute würde man von Pop-Up-Partys sprechen.
Und wie haben Sie sich den Ausgang finanziert?
Ich habe während meiner Uni-Zeit stets gejobbt. Und zwar meist Dinge, die überhaupt nichts mit dem Studium zu tun hatten. Mal war ich Gerüstbauer, Kellner, mal Chauffeur und einmal Magaziner im Zähringer-Migros. Mein Highlight war aber die Zeit, als ich für eines der ersten Berner Lokalradios als Redaktor tätig war. Damals in den Achtzigern entstanden die ersten freien Radiostationen und das Ganze hatte einen richtigen Pionierzeit-Groove.
«Ich führe das Leben eines 57-jährigen Familienvaters, ich lebe in ganz anderen Sphären als die Jugend.»
Heute sind eher die Sozialen Medien angesagt. Sie brauchen dort Hashtags wie #zämegeits und sind auf Facebook und Twitter aktiv. Reicht das, um die Jungen zu erreichen?
Wohl eher nicht. Für mich ist es schwierig, die Jungen zu erreichen. Ich führe das Leben eines 57-jährigen Familienvaters, ich lebe in ganz anderen Sphären. Am ehesten habe ich Kontakt zur organisierten Jugend wie beispielsweise dem Kinder- und Jugendparlament oder dann in Bildungseinrichtungen. Und ja, an den YB-Matchs, die sind auch generationenverbindend.
Die Jungen waren zuletzt politisch sehr aktiv. Werden Sie als Stadtpräsident den Forderungen der Klima-jugend gerecht?
Offensichtlich nicht. Deshalb lassen sie ja auch nicht locker. Für die Jungen handeln wir Politikerinnen und Politiker immer zu langsam. Das geht aber nicht nur ihnen so: Auch ich rege mich oft darüber auf, dass politische Veränderungen so schwerfällig sind. Städte sind aber weiter als die Bundespolitik, wo für grüne Anliegen oft die Mehrheiten fehlen. Deshalb sollte die Klimajugend noch enger mit den Städten zusammenarbeiten.
Was ist in Städten anders, abgesehen von der politischen Gesinnung?
Die Städte sind weltweit die Innovationstreiber, sie unterstützen die Nachhaltigkeit, die UNO und tragen die Folgen der weltweiten Migration. Bern hat den Vorteil, dass die Stadt relativ klein und übersichtlich ist. Die Wege sind kurz, auch in der Politik. Das bietet die Chance, Probleme schnell und unbürokratisch zu lösen. Das ist aber nicht immer möglich.
Haben Sie ein Beispiel?
Den ehemaligen Parkplatz auf der Schützenmatte wollten wir mit einer Zwischennutzung beleben. Obwohl die Idee gut ankam, blockierten Anwohner das Projekt mittels Einsprachen. Am Ende blieb den Zwischennutzern nichts anderes als der Rückzug. Das nervte mich sehr.
Abgesehen davon: Wie viel politischen Einfluss haben Sie als Stadtpräsident überhaupt?
Wohl weniger, als viele denken. Bei Ausgaben bis zu 300’000 Franken liegt die Entscheidungskompetenz bei der Stadtregierung. Bei höheren Ausgaben entscheidet automatisch der Stadtrat, ab 8 Millionen obligatorisch die Bevölkerung mittels Abstimmung.
Ihre Einflussmöglichkeiten beschränken sich aber kaum auf Ihre Budgetkompetenzen.
Nein. Am meisten Einfluss habe ich wohl mit «soft power», also dem was ich sage und ausstrahle. Als Stadtpräsident hat man da eine gewisse öffentliche Wirkung. In diesem Bereich war mein Vorgänger Alex Tschäppät sehr stark. Das bedingt aber, dass man vielerorts und oft präsent ist. Ich kann nicht abends um 18 Uhr sagen: «Tschüss, jetzt ist Privatleben, ich gehe nach Hause».
Das dürfte in Ihrer Zeit als Nationalrat nicht anders gewesen sein. Wieso wechselten Sie 2015 von der nationalen Politik zurück auf die Gemeindeebene?
Hauptsächlich aufgrund der Doppelbelastung. Nebst meinem Amt als Nationalrat war ich beruflich in einem Baukonzern engagiert. Beides zusammen ging nicht mehr.
«Ich kann nicht abends um 18 Uhr sagen: ‹Tschüss, jetzt ist Privatleben, ich gehe nach Hause›.»
Trotzdem liess Sie die Politik nicht los.
Nein. Bereits ein Jahr nach dem Rücktritt ergab sich die Möglichkeit zur Kandidatur für das Stadtpräsidium. Als Berufspolitiker bin ich nun voll auf die Stadt fokussiert. Gemeindepolitik hat zudem den Vorteil, dass man einen direkteren Bezug zu den Projekten hat und sofort Feedback erhält. Die Bundespolitik ist da viel abstrakter.
Jetzt sind Sie seit drei Jahren im Amt. Wie weit sind Sie mit Ihren Wahlversprechen, die Stadt belebter, nachhaltiger und gesünder zu machen?
Mit Ausnahme der Corona-Zeit ist die Stadt belebter und kulturell wurde das Angebot breiter. Auch in der Stadtentwicklung ist viel passiert. In einem anderen Projekt, der Fusion mit Ostermundigen und weiteren Nachbargemeinden bremste uns das Corona-Virus vorerst aus.
Ist Corona das Einzige, was solche politischen Prozesse bremst?
Ich denke, das ist auch eine Mentalitätsfrage. In der Schweiz sind wir oft angstgesteuert und grundsätzlich einer Nullfehler-Politik verhaftet. Dadurch trauen wir uns auch nicht, etwas auszuprobieren. Dieses Sicherheitsdenken stelle ich auf allen Ebenen fest – in der Politik und auch bei uns allen persönlich.

Was sind die Folgen davon?
Wir versuchen zu stark, Altes zu bewahren. Das ist so, weil es uns so lange gutging. Aber das Gute bewahren können wir nur, wenn wir uns ständig verändern. Gerade die Digitalisierung bringt enorme Chancen, uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln. Auch Bern könnte in dieser Hinsicht weiter sein.
Sprechen Sie damit E-Voting an?
Das ist nur ein Beispiel. Ich bin ein grosser Befürworter von E-Voting. Bereits heute läuft bei einer Abstimmung praktisch alles digital ab. Das Stimmregister, das Zählen, die Auswertung – alles ist digital organisiert. Das einzige was noch analog erfolgt, ist das Ausfüllen der Stimmzettel. E-Voting-Gegner blenden diese Tatsache oft aus. Tatsächlich könnte ein vollständig digitales Abstimmungssystem aber enorme Kosten sparen, neue Partizipationsformen ermöglichen und viel mehr Leute erreichen – insbesondere junge.
Wie ihr Nachname verrät, sind Sie sind Mitglied der Burgergemeinde. Alle in Bern wissen um deren Existenz, kaum jemand aber, was die genau macht.
Ja, und besonders Auswärtige können sich da gar kein Bild machen! Die Burgergemeinde ist ein historisches Überbleibsel. Sie stammt aus der Zeit, als sich die Gemeinde in eine politische Gemeinde und in die Burgergemeinde aufteilte. Die Burgergemeinde ist aber nach wie vor eine richtige Gemeinde mit öffentlichen Aufgaben, für ihre Angehörigen richtet sie die Sozialhilfe und den Kindes- und Erwachsenenschutz aus. Heute hat sie weltweit 20’000 Mitglieder, davon etwa 10’000 in Bern und sie ist vor allem bekannt für ihr kulturelles und soziales Engagement. Sie finanziert zum Beispiel das Casino, das Naturhistorische Museum und unterstützt viele weitere Institutionen ideell und finanziell, so auch die Uni. Wie ist das demokratisch legitimiert? Die Burgergemeinde ist tatsächlich sehr abgeschlossen. Dafür wurde und wird sie auch kritisiert, ihr Fortbestehen wurde bereits mehrfach in Frage gestellt. Ich sage immer: Die Burgergemeinde ist nur eine kantonale Volksabstimmung von ihrer eigenen Auflösung entfernt. In diesem Sinne muss sie sich immer wieder beweisen. Im Moment geniesst sie allseitig Respekt und macht ihren Job gut.
«Die Burgergemeinde ist nur eine kantonale Volksabstimmung von ihrer eigenen Auflösung entfernt.»
Zurück zur Stadt selbst: Wo ist Bern anderen Schweizer Städten voraus?
Die kulturelle und urbane Dichte hier ist enorm hoch, eben gerade weil Bern eher klein ist. Auch wirtschaftlich war die Stadt stets innovativ, hat aber einige grosse Chancen verpasst. Mit der Firma Ascom hätten wir die Möglichkeit gehabt, zum Silicon Valley der Schweiz zu werden. Die Ascom ist aber stark geschrumpft und nicht mehr in Bern. Mit dem Inselspital haben wir aber das grösste Krankenhaus der Schweiz, hier besteht aktuell das grosse Innovations- und Zukunftspotential. So ist Bern im Bereich der Medizinaltechnik schweizweit führend.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft: 2050 werden wir etwa gleich alt sein wie Sie jetzt. Was charakterisiert die Bundesstadt im Jahr 2050?
Ich hoffe, sie ist immer noch die lebenswerteste Stadt der Schweiz. Die Altstadt wird immer noch das Zentrum von Bern sein. Ich hoffe aber, dass sich Bern bis dahin mit seinen umliegenden Gemeinden vereinigt hat. Und bis dann ist die Schweiz Netto-Null, Bern schon 15 Jahre früher…
Davon sind wir aber noch weit entfernt. Der Energieverbrauch der Stadt Bern ist alles andere als erneuerbar.
Aber der Trend zu 100% erneuerbar ist unumkehrbar. Es stellt sich einzig noch die Frage, wie viel vom Öl und vom Gas wir bis dahin noch verbrennen werden.
«Mit der Firma Ascom hätten wir in Bern die Möglichkeit gehabt, zum Silicon Valley der Schweiz zu werden.»
Viele werden wohl kaum auf ihren Billigflug nach London verzichten wollen.
Dafür habe ich nur wenig Verständnis. Ich bin mal mit dem Zug nach Istanbul gereist – ein andermal per Schiff und Zug nach Marrakesch. Aktuell plane ich eine Zugreise nach Lemberg und Kiew. Eine solche Reise ist nicht nur Transport von A nach B, sondern auch heute noch ein richtiges Erlebnis.
Apropos Erlebnis: Sie haben ein Buch mit dem Titel «Mein Bern, 77 Erlebnistipps des Stadtpräsidenten» herausgegeben. Warum?
Ich bin vom Verlag gefragt worden, darum (lacht). Aber ich stehe zu dem Buch. Ich zeige darin einige meiner Lieblingsorte, wobei es in Bern noch viel mehr zu entdecken gäbe – auch für mich als Stadtpräsidenten.
Wenn Sie einen der 77 Tipps rauspicken müssten, welches ist Ihr liebster?
Natürlich die Aare! Wie viele bin ich ein grosser Aare-Fan. Bern gilt ja als langsam und behäbig, die Aare aber ist sehr dynamisch. I like!