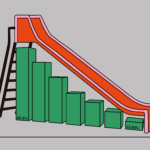«Das Fussballfeld ist ein kleines Abbild der Gesellschaft.»

Sarah Akanji im Gespräch mit der bärner studizytig (Bild: Noah Pilloud)
Ihr engagierter Einsatz für den Frauenfussball machte sie bekannt. Seither startet Sarah Akanji auch in der Politik durch. Der bärner studizytig erklärt die Politikwissenschaftlerin, was die beiden Engagements miteinander verbindet.
Du kandidierst für den Zürcher Kantonsrat. Welches Thema würdest du als erstes im Kantonsrat angehen, wenn du gewählt würdest?
Zurzeit hat die Klimapolitik Priorität, gerade bei den Jungen in der ganzen Schweiz, aber auch in der Stadt Zürich. Dieses Thema ist so aktuell und dringend, dass wir aktiv werden müssen, um Umweltschutz und Klimaziele irgendwann zu erreichen. Das müssen wir jetzt anpacken. Die ganze Jugendbewegung hat sich jedoch erst in den letzten paar Wochen und Monaten entwickelt.
Hattest du vor dem Aufkommen der Klimastreiks einen anderen Fokus?
Für mich ist die Gleichberechtigung ein sehr wichtiges Thema, nicht erst, seit ich mich in der Politik engagiere. Es ist ein Thema, das immer wieder aufgegriffen und gepusht werden muss. Aber ich muss nicht nur für ein Thema stehen. Es gibt mehrere Themen, in denen ich mich finde. Die Klimapolitik und die Gleichberechtigung sind sicher zwei, die ich forcieren möchte.
Welche Massnahmen sollten denn bei der Klimadebatte ergriffen werden?
Es kann einfach nicht sein, dass beispielsweise Flugtickets so günstig sind im Vergleich zum ÖV. Wir haben ein sehr gutes Zugnetz, auch, was die Verbindungen in umliegende Staaten angeht. Die Preisverhältnisse stimmen absolut nicht und es muss ein Anreiz geschaffen werden, um vermehrt auf den für die Umwelt schonenderen ÖV umzusteigen. Ferner kann es nicht sein, dass grosse Firmen, die die Umwelt viel mehr verschmutzen, viel weniger Vorgaben und Schranken haben. Das geht so nicht mehr! Wir müssen fordern, dass Unternehmen bestimmte Ziele erfüllen. Das können wir entweder mit Anreizen und Belohnungen erreichen, sodass beispielsweise diejenigen Firmen einen Vorteil erhalten, die umweltfreundlich produzieren, oder indem wirklich Massnahmen umgesetzt werden.
Das klingt eher nach einem nationalen Problem, einem, das man auf höherer Ebene angehen müsste. Gibt es auch ein Thema auf kantonaler oder lokaler Ebene, das für dich Aktualität hat?
Allgemein liegt mir der Sport sehr am Herzen, auch in Winterthur. Winterthur hat zum Beispiel ein einziges Hallenbad, was sehr wenig ist. Das ist zwar eher eine Stadtsache, aber allgemein würde ich mich dafür einsetzen, dass mehr in den Sportfonds investiert wird. Im Moment haben wir gerade die Situation, dass die Pfadi Winterthur – also der Kultclub von Winterthur – fast am Untergehen ist. Das sind Dinge, die in meinen Augen einfach nicht passieren dürfen. Wir müssen mehr in den Sportfonds investieren, damit ein vielfältiges und nachhaltiges Angebot für junge Leute entsteht und damit die Sportvereine und -veranstaltungen auf guten Beinen stehen. Zudem sollten Randsportarten gefördert werden. Dasselbe gilt für den Kulturbereich. Das ist etwas sehr Wertvolles. Winterthur ist für mich eine Kulturstadt – das muss subventioniert, unterstützt und wertgeschätzt werden.
«Über Frauenfussball hingegen denkt man: ‹Ah ja, den gibt es auch noch.› Das ist ein Spiegel der Gesellschaft.»
Neben der Politik ist Sport ein wichtiger Bereich in deinem Leben. Was verbindet für dich Sport und Politik?
Ich finde, dass das Fussballfeld beispielweise ein kleines Abbild der Gesellschaft ist. Ich habe mich hauptsächlich für den Frauenfussball stark gemacht; dort merkt man, wie sehr in den Köpfen von ganz vielen Menschen diese Rollenbilder noch verankert sind, wonach Frauen nicht Fussball spielen sollten oder wenn, dann nur auf dem Nebenplatz. Auch wenn ich glaube, dass nicht die ganze Gesellschaft so denkt, ist Fussball dadurch für mich extrem politisch – gerade weil Männerfussball einen ausserordentlichen Stellenwert hat. Er wird gepusht, gefördert und anerkannt. Über Frauenfussball hingegen denkt man: «Ah ja, den gibt es auch noch». Das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Da habe ich die Verbindung gemacht, dass mir die Gleichberechtigung nicht nur im Fussball wichtig ist, sondern allgemein, im Kanton Zürich, in der Schweiz, überall.
Trotzdem wird der Sport in der Öffentlichkeit oft als apolitisch wahrgenommen, auch weil Sportler*innen sich selten politisch äussern.
Ich bin der Überzeugung, dass Sport für alle sein soll. Es kann nicht sein, dass nur Menschen mit einer gewissen politischen Einstellung Sport treiben dürfen. Es ist sehr wichtig, dass alle Menschen den Zugang dazu finden. Ich glaube, Sportvereine geben sich gegen aussen apolitisch, weil sie vielleicht nicht Leute vergraulen und wütend machen oder Sponsoren, auf die sie angewiesen sind, verlieren wollen. Aber Sport hat eine sehr wichtige Funktion. Beispielsweise, was die Integration von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen anbelangt, die im gesellschaftlichen Leben vielleicht nicht so sehr verbunden wären. Und vielleicht allgemein die Chancengleichheit: Auf dem Fussballplatz geht es darum, wer die beste Leistung bringt oder wer am meisten Einsatz gibt oder am meisten investiert. Man hat dort eine andere Möglichkeit, sich selber entwickeln und entfalten zu können. Für mich ist Sport absolut politisch. Vielleicht nicht in dem Sinn, dass Sportvereine das gegen aussen zeigen, aber Sport als solcher hat einen grossen politischen Wert für die Gesellschaft.

Bild: Noah Pilloud
Es ist spannend, dass du das Thema Chancengleichheit ansprichst. Der französische Philosoph und Soziologe Roger Caillois hat einmal gesagt, dass die Regeln eines Spiels die Regeln einer Gesellschaft widerspiegeln. Im Fussball stehen pro Team elf Leute auf dem Platz, beide spielen einmal auf jeder Seite, die Tore sind gleich gross. Das einzige, das dem Zufall überlassen wird, ist der Münzenwurf am Anfang. Ist der Fussball damit ein Abbild vom Ideal unserer Gesellschaft?
Vielleicht das Fussballspiel an sich, das schon. Aber nur schon, wenn es darum geht, in einen Verein zu kommen, bin ich mir nicht sicher, wie hier das Verfahren jeweils abläuft. Es gibt viele Kinder, die Fussball spielen möchten. Es gibt Vereine, in denen Mädchen Fussball spielen wollen, doch es heisst: «Wir haben keinen Platz, die anderen sind halt schon da», und dann gibt es dort zehn Jungen-Fussballteams und ein Mädchenteam. Wenn man Platz für zehn Jungenmannschaften, aber nur für eine Mädchenmannschaft hat, sehe ich das nicht als Chancengleichheit. Vielleicht herrscht also Chancengleichheit auf dem Platz, innerhalb des Spiels, doch bei allem, was Fussball beinhaltet, bin ich mir nicht so sicher. Aber er geht um Leistung, vielleicht ist das auch ein Abbild unserer Gesellschaft.
Wie lässt sich deiner Meinung nach Chancengleichheit im Sport erreichen?
Mir ist sehr wichtig, dass jemandem keine Hürden in den Weg gestellt werden. Es gibt einfach weniger Angebote für Frauen. Ich bin ja im Wiesendangen aufgewachsen und hätte für das Fussballtraining nach Zürich oder nach St. Gallen gehen müssen. Es hatte weniger Clubs, ich musste einen weiten Weg auf mich nehmen und irgendwann habe ich mir gesagt: «Das geht einfach nicht.» Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, die Möglichkeiten zu haben, sich darin entwickeln zu können, worin man stark ist. Chancengleichheit bedeutet für mich vor allem, dass man sich als Individuum dort entwickeln kann, wo man will, worin man sich selber wohl fühlt und vielleicht auch talentiert ist. Das ist nicht nur im Fussball, sondern überall sehr wichtig.
«Es ist dem ganzen Team sehr wichtig, der Gesellschaft zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir Unterstützung wollen.»
Auch innerhalb des Fussballs kommen immer wieder Debatten zur Chancengleichheit auf, beispielsweise im nationalen Fussball. Nicht alle werden auf dieselbe Weise behandelt. Gewisse müssen mehr leisten als andere, gerade die Spieler*innen mit Migrationshintergrund. Es wird viel häufiger hinterfragt, ob sie ihrem Team gegenüber wirklich loyal sind.
Gleichbehandlung existiert vielleicht nicht, aber Chancengleichheit schon – wenn du einmal drin bist. Dann geht es einfach um deine Leistung. In der Repräsentation gegen aussen hingegen ist es anders. Es gibt Spieler – sagen wir Doppelbürger – die immer wieder sagen müssen: «Ich bin Schweizer, die Schweiz ist mir wichtig, ich habe mich für die Schweiz entschieden», und sich dauernd rechtfertigen müssen. Das ist allgemein etwas, das mich ziemlich traurig macht. Diese ganze Doppelbürgerdebatte hat vor allem ausserhalb des Fussballs Fuss gefasst, was für mich völlig unverständlich ist. Jemand, der sich für die Schweiz entscheidet, soll für die Schweiz spielen. Die Person hat sich ja aus einem gewissen Grund dafür entschieden. Das sollte gar nicht hinterfragt werden. Es ist ja auch nicht so, dass man sich für einen Pass entscheiden muss, wenn man zwei Pässe hat. Man kann sich beiden Länder genau gleich verbunden fühlen.
Man merkt, dass du durch den Fussball und das Kämpfen für ein Frauenteam beim FC Winterthur politisiert wurdest. Hast du das Gefühl, du seist ein Einzelfall, oder ging es deinen Mitspielerinnen auch so, dass sie dadurch politisiert wurden?
Meine Mitspielerinnen wurden eigentlich sehr spät in das Projekt involviert. Es war einer der letzten Schritte, das Team zusammenzustellen. Zuerst mussten alle Grundlagen geschaffen werden. Ich glaube schon, dass viele politisch sensibilisiert worden sind. Vielleicht nicht bewusst für die Schweizer Politik, doch für das Selbstverständnis: «Hey, wir haben das Recht, da zu sein, wir haben ein Recht darauf, zu spielen.» Es ist dem ganzen Team sehr wichtig, der Gesellschaft zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir Unterstützung wollen. Es gab auch einige Mitspielerinnen, die bereits politisch interessiert waren, dies aber noch nicht gegen aussen getragen haben. Mit denen stehe ich jetzt im Austausch, teilweise über den Fussball, teilweise über Gleichstellungsfragen. Ich glaube, manche wurden dadurch schon sensibilisiert, aber nicht alle. Das muss auch nicht sein. Diejenigen, die sich dafür interessieren, sollen sich dafür einsetzen, aber das heisst nicht, dass das ganze Team politisch sein muss und politische Statements setzen muss.

Bild: Noah Pilloud
Du hast ja lange dafür gekämpft, dass es überhaupt erst ein Frauenteam beim FC Winterthur gibt. Wie sieht es mit der Ungleichbehandlung aus, jetzt, da es das Team gibt?
Es ist nun mal ein Novum beim FC Winterthur. Der FC Winterthur hatte nur Männer und Jungen, die die ganze Zeit gefördert wurden. Wir sind neu hereingeplatzt. Ich glaube, die Gleichstellung wird sich schrittweise entwickeln. Es hiess von Anfang an, wir dürften unter dem Namen spielen, dürften dazugehören, dürften einen Platz und die Garderobe haben. Das ist schon einmal sehr schön, denn die Gründung des Frauenteams kam für den Verein aus dem Nichts. Wir müssen nun im ganzen Verein kommunizieren, dass es uns gibt, dass wir jetzt auch da sind und einen Platz brauchen. Aber ich finde, dass wir gut aufgenommen wurden. Vieles kann der FC Winterthur alleine auch gar nicht erreichen, beispielsweise die Medienpräsenz. Was den Platz angeht, spielen wir im Moment auf dem Kunstrasen und hoffen, dass wir irgendwann auch auf dem anderen Platz spielen dürfen. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Wir sind in einem guten Austausch mit der Geschäftsleitung und ich bin gespannt, wie sich das Projekt in den nächsten zwei Jahren entwickeln wird.
«Ich bin eine Person, die sich immer genervt und gestört hat und gewisse Dinge in Frage gestellt hat, aber in meiner Jugend wusste ich nicht, wie ich etwas tun könnte.»
Rechnest du mit einem Zuwachs?
Mir ist es sehr wichtig, dass dieses Projekt nachhaltig gestaltet wird, dass wir irgendwann Juniorinnen haben, die ins Frauenteam nachrücken können. So kann schliesslich ein Kreislauf entstehen. Dafür brauchen wir Platz, aber den werden wir auch einfordern. Zudem braucht es Trainerinnen, Unterstützung und Geld. Es braucht viel, aber ich bin optimistisch, dass wir uns gerade in der richtigen Zeit befinden, um das zu verwirklichen.
Wie bist du von deinem Engagement für ein Frauenfussballteam zum klassisch politischen Engagement in einer Partei gekommen?
Das wird immer etwas überspitzt dargestellt, dass ich nur durch den Fussball politisiert wurde. Ich muss da viel weiter ausholen. Innerlich war ich schon immer ein politischer Mensch. Ich bin eine Person, die sich immer genervt und gestört hat und gewisse Dinge in Frage gestellt hat, aber in meiner Jugend wusste ich nicht, wie ich etwas tun könnte. Ich habe deshalb auch begonnen, mich für Geschichte, für Gesellschaftsstrukturen und -veränderungen und für Einzelpersonen, die etwas bewirken konnten, zu interessieren. Und das ist an sich ja schon politisch. Ich schrieb auch meine Maturaarbeit über ein politisches Thema. Ich habe mich dann dafür entschieden, Geschichte und Politik zu studieren, da dies in meinen Augen eine sehr gute Verbindung ist. Dass ich dann zur Parteipolitik gekommen bin, geschah aus Interesse. Ich wollte wissen, wie wichtig Parteien bei uns in der Schweiz sind. Als ich dann das Praktikum bei der SP Zürich ausgeschrieben sah, dachte ich: «Das ist mein Traumpraktikum.» Ich wunderte mich wirklich, wie das überhaupt funktioniert, wie es ist, in einer Partei zu sein und wie viel Einfluss die Parteien überhaupt auf das politische Geschehen haben. So bin ich in die Parteipolitik gekommen. In diesem Praktikum merkte ich dann auch, wie viele Macher*innen sich in dieser Partei bewegen und wie engagiert sie sind. Sie packen einfach an, statt sich zu beklagen. Das beeindruckte mich und ich wollte auch ein Teil davon sein. Dieses Umfeld ist genau das, was ich mir wünsche, wo ich mich wohl fühle und ich mich vertreten fühle. Darum bin ich dann sehr schnell in die SP reingewachsen. Im Nachhinein war das Praktikum der beste Schritt, den ich machen konnte.
Ein etwas radikaler Themenwechsel: Wir haben uns mit deiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt. Du schreibst, dass die Entsendung deutscher Frauen in die deutschen Kolonien um die Jahrhundertwende zum Ziel hatte, die weisse Rasse und deutsche Kultur zu bewahren. Warum fiel diese Rolle den Frauen zu?
Das fand ich auch eine extrem spannende Frage. Ich glaube, es war schlicht der einfachste Weg: Die Männer waren schon in den Kolonien und repräsentierten dieses stereotype Männliche von damals, mit dem Kampf, der Jagd auf wilde Tiere und dem Aufrechterhalten eines Herrschaftssystems. Sie waren also primär da, um Politik zu machen. Die Kultur hingegen wurde als etwas Weicheres betrachtet. Frauen gab es noch zu wenig in den Kolonien, deshalb ergab es sich auch relativ gut, mit ihnen zugleich die Kultur in die Kolonien zu bringen. Ich denke nicht, dass das Ganze so durchdacht war in dem Sinne, dass den Frauen speziell die Aufgabe der Kulturträgerinnen zukam. Es hat sich vielmehr als praktisch erwiesen, als man sah, dass die Männer dort unten die deutsche Kultur weniger verbreiteten, sondern sich auf afrikanische Frauen einliessen und die Kulturen «vermischten». Daher ersann man, die «reinen deutschen Frauen» zu senden.
In den Kolonien liessen sich nicht immer die exakt gleichen sozialen Hierarchien aufrechterhalten wie in Deutschland, was bei manchen Frauen die Hoffnung auf Emanzipation weckte. Du stellst aber fest, dass kaum von Emanzipation die Rede sein kann, da sich die soziale Aufwertung der Frauen mehr auf die Abwertung der kolonialisierten Bevölkerung stützte. Damit wurde letztlich eine diskriminierte Gruppe gegen eine andere ausgespielt. Auch heute berufen sich rechtspopulistische Parteien auf den Feminismus, um gegen Migrant*innen zu hetzen. Wie lässt sich das verhindern?
Mein Rezept dazu ist die Solidarität. Man muss im Austausch stehen und die Menschen nach ihrer Situation fragen. Ich finde das extrem spannend, denn ich sehe mich in der Schweiz weniger privilegiert als Männer und zugleich fühle ich mich meiner Hautfarbe wegen in einer Randgruppe. Deshalb kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn sich beispielsweise ein Mann mit dunkler Hautfarbe nicht für feministische Themen interessiert. Der einzige Weg, das zu erreichen, ist Sensibilisierung. Dazu muss den Leuten die Situation bewusst gemacht werden. Die meisten Menschen in einer Gesellschaft sind in gewissen Situationen in der Minderheit, sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Was eine Minderheit ist, das wechselt ja je nach Kontext und je nach Gruppe. Ich glaube, alle kennen das Gefühl, irgendwo nicht dazuzugehören, irgendwo nicht richtig wahrgenommen zu werden.
Die Idee, dass alle Diskriminierungen gleich sind und man sich deshalb solidarisieren muss, existiert ja schon lange. Es gab bestimmt auch Momente, wo das klappte. Es gibt jedoch auch immer wieder diese Momente, wo beispielsweise Menschen in wirtschaftlich prekären Situationen denken, Migrant*innen seien schuld an ihrer Situation.
Das glaube ich auch. Aber das ist teilweise auch eine Strategie gewisser politischer Organisationen, Parteien und Bewegungen. Dem gilt es entgegenzutreten. Ich wünsche mir fest, dass das nicht einfach auf einem Uni-Level stattfindet, sondern dass es in die Bevölkerung runterfliesst. Wenn man das Problem erkennt, aber nichts dagegen tut, entsteht Stillstand. Ich finde, das ist das Wichtigste: auf die Bevölkerung zu hören und eine Verbindung der Politiker*innen zu der Bevölkerung zu schaffen und die unterschiedlichsten Sorgen wahrzunehmen. Ich bin mir sicher, dass es Gründe gibt, weshalb jemand sich von Migrant*innen bedroht fühlt. Wir müssen in der Politik darauf hinarbeiten, durch verbesserten Austausch diese Gründe zu verstehen und anzugehen.
Im Artikel der SonntagsZeitung über dich gibst du Nelson Mandela und Mattea Meyer als Vorbilder an. Was beeindruckt dich an ihnen?
Bei Nelson Mandela ist es hauptsächlich seine Stärke und sein Durchhaltewillen, dafür zu kämpfen, was ihm wichtig ist, obwohl er sich selbst in extreme Gefahr begab. Er hat seine Ideen und seine Vorstellungen einer gerechteren Welt über sein eigenes Wohlbefinden und sein eigenes Überleben gestellt. Das beeindruckt mich zutiefst und von dieser Einstellung könnten sich viele eine Scheibe abschneiden: bereit zu sein, einen Teil seiner Privilegien abzugeben für das, was einem wichtig ist. Ich finde es schlimm zu sehen, wie sich Menschen über etwas aufregen, aber nichts machen. Genau das ist es auch, was ich an Mattea bewundere: Sie stört sich an etwas und sie macht etwas dagegen. Ich erhoffe mir sehr, dass sich viele von dieser Qualität inspirieren lassen. Denn nur so kommt unsere Gesellschaft weiter.
Du kandidierst wie bereits angesprochen für den Kantonsrat. Im Herbst sind Nationalratswahlen. Ist das auch schon ein Thema für dich?
Nein, für mich ist das kein Thema. Ich möchte mich wirklich auf den Kantonsrat fokussieren. Das ist ein grosses und wichtiges Ziel von mir. Im Moment gibt es Menschen, die besser auf dieses Amt vorbereitet sind als ich. Ich denke, ich brauche auch noch Zeit – hoffentlich als Kantonsrätin – aber auch sonst, um mich weiterzuentwickeln. Auch, um mich mehr mit den nationalen Themen auseinandersetzen zu können, um dann irgendwann vielleicht in der Zukunft für den Nationalrat zu kandidieren. Doch momentan fühle ich mich noch nicht bereit dazu.