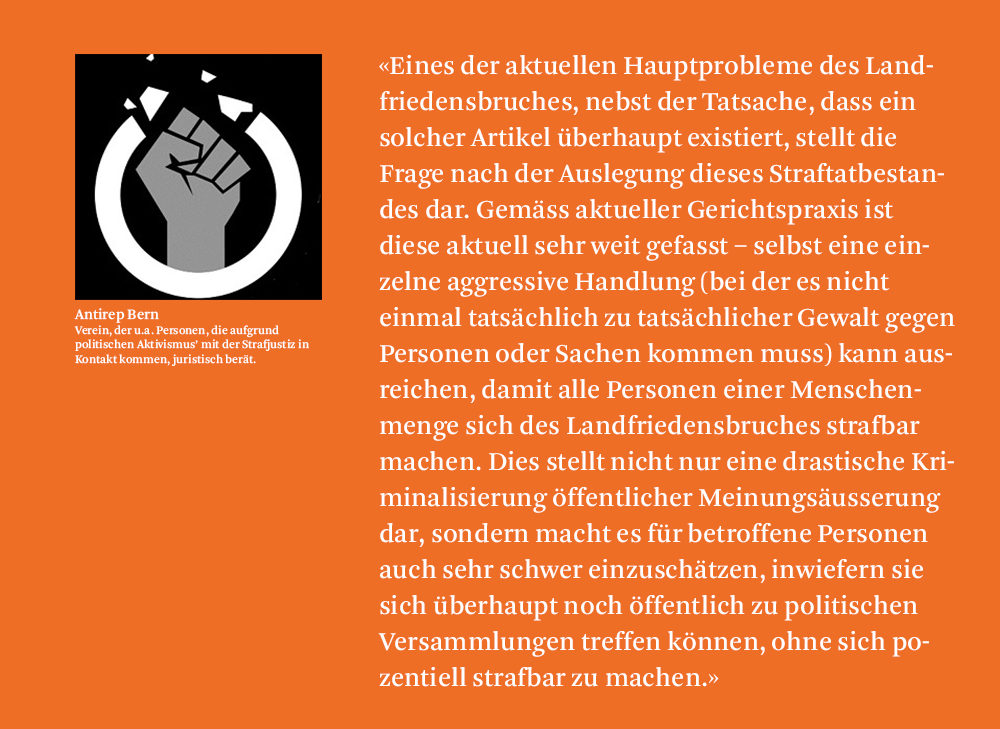Beweisnot macht erfinderisch
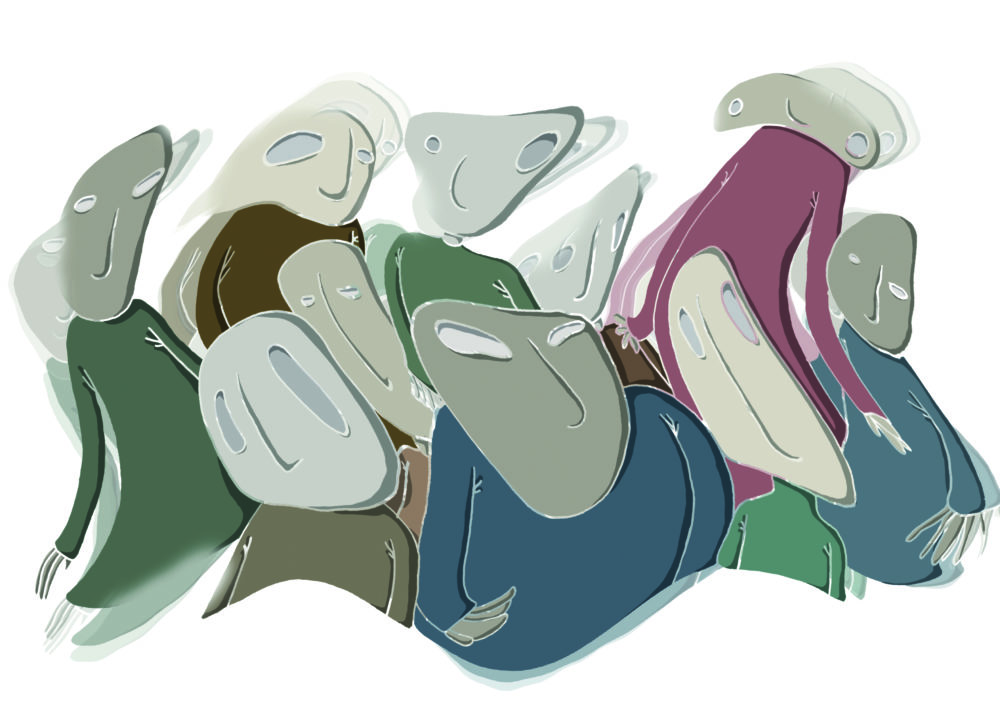
Der Tatbestand des Landfriedensbruchs ist dehnbar und kann zu Verdachtsstrafen führen. (Illustration: Nico Schmezer)
Der Tatbestand «Landfriedensbruch» wurde konstruiert, um Beweisschwierigkeiten bei gewalttätigen Massenveranstaltungen zu verhindern – entsprechend flexibel ist der Paragraph. Trotzdem will der Ständerat die Mindeststrafe für Landfriedensbrecher*innen jetzt deutlich hochschrauben.
Es ist der 19. Juni 1893. Auf dem Berner Bahnhofsplatz versammeln sich an die 60 arbeitslose Bauarbeiter und ziehen randalierend zu den Baustellen in den Aussenquartieren. Dort demolieren sie aus Wut über die hohe Arbeitslosigkeit im Baugewerbe Gerüste und verprügeln italienische Arbeiter, denen sie die Schuld für die eigene Arbeitslosigkeit geben. Als Antwort auf die Festnahme einiger Demonstranten kommt es vor dem Käfigturm, der damals noch als Polizeigefängnis dient, zu heftigen Auseinandersetzungen, denen sich im Laufe des Abends zahlreiche weitere Personen anschliessen. Während Polizei und Feuerwehr mit Säbeln die Meute zurückdrängen, schiessen die Landjäger, ein spezielles Korps der Polizei, mit ihren Revolvern aus den Fenstern des Turms. Noch in derselben Nacht treffen auf Anordnung des Stadtpräsidenten 63 Artilleristen der Schweizer Armee ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Es folgen weitere Truppen am nächsten Morgen. Noch vier Wochen verweilt dieser Ausnahmezustand in Bern. Der Protest geht als «Käfigturmkrawall» in die Geschichte ein.
Als im Januar 1895 eine Expertenkommission, bestehend aus Richtern, Anwälten, Professoren, Politikern und Staatsmännern den Vorentwurf zum ersten eidgenössischen Strafgesetzbuch berät, steht sie massgeblich unter dem Eindruck des Krawalls. Ganz besonders Xaver Gretener, ein Rechtsprofessor aus Bern. Er will nach deutschem Vorbild den Tatbestand des Landfriedensbruchs auch in der Schweiz einführen. Bei Ausschreitungen einer Volksmenge falle es ungemein schwer, dem einzelnen Teilnehmer nachzuweisen, was er verübt habe, argumentiert Gretener. Deshalb soll alleine die Teilnahme an einer solchen gewalttätigen Kundgebung strafbar werden. Es gibt in der Kommission auch Gegenstimmen. Der Tatbestand des Landfriedensbruchs sei überflüssig, wird Gretener entgegnet, weil Personen so doppelt bestraft würden – einerseits für konkrete Gewalttätigkeiten, etwa Sachbeschädigungen, andererseits für Landfriedensbruch. Am Ende jedoch siegt Gretener, auch wenn er es nicht mehr miterlebt. Er stirbt am 27. August 1933 im Alter von 81 Jahren in Breslau im heutigen Polen. Sein Erbe aber lebt weiter. Am 1. Januar 1942 tritt das erste eidgenössische Strafgesetzbuch in Kraft und mit ihm auch der Artikel 260, Landfriedensbruch.
Etwas tun gegen Gewalt an Kundgebungen
Mehr als 100 Jahre nach Greteners Vorstoss in der Expertenkommission ist der Landfriedensbruch wieder Thema im Bundeshaus. In der diesjährigen Sommersession besprach der Ständerat eine Motion von Beat Rieder (CVP), die verlangte, dass die Mindeststrafe für Landfriedensbrecher*innen zwingend auf Geldstrafe und Gefängnis lauten müsse. Rieder wählte drastische Worte für sein Anliegen: «Die stark steigende Zahl dieser Straftaten mit zum Teil krassen Gewaltausbrüchen – ich verweise auf das Beispiel Hamburg 2017, aber auch auf Bern 2017 – braucht eine entsprechende Antwort des Staates, wenn er nicht Gefahr laufen will, in diesem Bereich sein Gewaltmonopol zu verlieren.» Die Zahl der Verurteilungen für Landfriedensbruch habe über die Jahre stetig zugenommen, 2015 seien es bereits 186 gewesen, erklärt er (Anm. d. Red. Die Verurteilungen für Landfriedensbruch erreichten 2011 zwar einen Höchstwert, sind seither aber rückläufig. 2017 waren es gar wieder unter 100 Verurteilungen). «Sind Sie der Meinung, dass ein Strafmass einen Gewalttäter bei den Vorfällen in Bern und Hamburg auch nur im Geringsten treffen könnte, wenn es eine bedingte Geldstrafe ist?», fragt Rieder am Ende seiner Ansprache rhetorisch.

Polizisten drängen während des Käfigturmkrawalls 1893 die wütende Meute mit Säbeln zurück. (Zeichnung von Louis Tinayre. Bernisches Historisches Museum. Foto: S. Rebsamen)
Rieders Motion ist Auswuchs der Überzeugung, dass (vermeintlich) höherer Kriminalität mit höheren Strafen beizukommen ist. Und sie ist die logische Fortsetzung der bereits vor einem Jahr erfolgten Erhöhung des Strafmasses beim Straftatbestand «Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte» – ein Delikt, das, gleich wie der Landfriedensbruch, typischerweise an Massenveranstaltungen begangen wird. Um die vermeidliche Problematik der Kundgebungsgewalt umfassend anzugehen, muss nun also auch der Landfriedensbruch angegangen werden.
Keine Beweise? Landfriedensbruch!
Es mag unschön sein, dass Rieders Motion dieser bürgerlichen Gesetzgebungslogik folgt. Bedenklich ist sie aber vor allem deshalb, weil der Tatbestand, auf dem sie aufbaut, erhebliche Probleme mit sich bringt. Blickt man auf die Entstehungsgeschichte des Landfriedensbruchs – zum Beispiel auf das Votum Greteners in der Expertenkommission – so wird klar, dass das tragende Motiv das Vermeiden von Beweisschwierigkeiten ist: Weil es bei Massenveranstaltungen wie Demonstrationen oder Fussballspielen schwierig ist, einzelne Täter*innen festzunehmen, wird der Einfachheit halber schon die einfache Teilnahme an gewalttätigen Veranstaltungen bestraft. Diese rein pragmatische Herangehensweise ist rechtsstaatlich problematisch. Deshalb wird oft angefügt, das zu bestrafende Unrecht bestehe auch in der massenpsychologischen Unterstützung der Gewalttäter*innen. Dieser Ansatz ist aber gleich in zweifacher Hinsicht heikel.
Erstens bauen die dem Landfriedensbruch vermeidlich zugrundeliegenden massenpsychologischen Phänomene auf dem Werk des französischen Psychologen Gustav Le Bon auf. Der schrieb in seinem bekanntesten Werk «Psychologie der Massen» aus dem Jahr 1895: «Die blosse Zahl der Anwesenden weckt im Einzelnen das Gefühl unwiderstehlicher Macht und weckt in ihm Triebe, welche er sonst gezwungenermassen zurückdrängt.» Nach Le Bon verlieren Menschen in der Masse Persönlichkeit, Denkfähigkeit und Wille; alles passiert wie in Hypnose. Dieses durch Le Bons Massenpsychologie geprägte Bild der Gefährlichkeit der Masse – das heute als überholt und undifferenziert gilt – war mithin ein Grund für die Einführung des Landfriedensbruch-Artikels in der Schweiz. So hielt Alfred Gautier, Professor für Strafrecht an der Universität Genf und ebenfalls Teil der Expertenkommission von 1895 die Strafbarkeit aller Teilnehmer*innen an gewalttätigen Kundgebungen deshalb für gerechtfertigt, weil diese durch ihre Anwesenheit die Masse vergrössern und den Mut potenzieller Gewalttäter*innen steigerten. Sie trügen demnach auch einen Teil zur Atmosphäre bei, welche die Begehung von Delikten begünstige.
Nach Le Bon verlieren Menschen in der Masse Persönlichkeit, Denkfähigkeit und Wille; alles passiert wie in Hypnose.
Zweitens berücksichtigt der Tatbestand des Landfriedensbruchs, in seiner derzeitigen Form und Auslegung, den individuellen psychologischen oder auch physischen Beitrag einer Person zu einer aus der Masse heraus begangenen Tat gar nicht. Oder anders gesagt: Ob jemand Gewaltäter*innen lautstark anfeuert oder sie zu besänftigen versucht, zählt vor Gericht keinen Pfennig. Das Bundesgericht fällte diesbezüglich bereits vor mehr als 30 Jahren einen Leitentscheid. Bis 1982 verlangten die Gerichte von der Staatsanwaltschaft einen Nachweis, der zeigte, dass die beschuldigte Person die an einer Kundgebung verübte Gewalt kannte und sie (mindestens stillschweigend) billigte. So wurde zum Beispiel das Mitführen von Wurfgegenständen oder verbale Äusserungen wie das Beschimpfen von Polizisten und Polizistinnen als «Faschistenschweine» oder der Ausspruch «gönd druff» als Billigung der Gewalttätigkeiten ausgelegt. Konnte dieser Beweis nicht erbracht werden, wurde die Person freigesprochen. Im Zug der Jugendbewegung der 80er-Jahre rückte das Bundesgericht jedoch von dieser Praxis ab. Fortan genügte es, «wenn der Täter (sic) sich wissentlich und willentlich einer Zusammenrottung, d.h. einer Menschenmenge, die von einer friedensbedrohenden Grundstimmung getragen wird, anschliesst oder in ihr verbleibt». Denn wer solches tue, müsse mit Gewalttätigkeiten rechnen, heisst es im Urteil. Und weiter: «Der Nachweis einer Zustimmung zu ihnen ist nicht geboten.»
Hans Vest, Professor für Strafrecht in Bern schreibt deshalb in einem Kommentar richtigerweise, dass der eigentliche Grund für die geltende Fassung des Artikel 260 eben doch in der Beweisnot liege. «In seiner praktischen Handhabung dient der Straftatbestand insbesondere der Umgehung von Beweisschwierigkeiten bei Massendelikten durch Vorverlagerung des Strafschutzes», stellt Vest fest. Oft würde der Tatbestand ausserdem selektiv angewendet, also gegen mutmassliche Rädelsführer*innen, denen die Verübung von Gewalttätigkeiten nicht nachgewiesen werden könne. Diese selektive Handhabe führe zu Verdachtsstrafen, Strafen also, die ohne Beweise, alleine aufgrund eines Verdachts gefällt werden. Am problematischsten aber ist die Wirkung des Tatbestands für die wohl oft überwiegende Mehrheit der friedlichen Demonstranten und Demonstrantinnen. «Gelingt es den Ermittlungsbehörden nicht, die der eigentlichen Gewalttätigkeiten Verdächtigen festzunehmen, so gestattet Art. 260 StGB (Anm. d. Red. StGB steht für Strafgesetzbuch) eine stellvertretende Haftung ihres Umfelds.» Statt den eigentlichen Gewalttäter*innen müssten dann friedliche Demoteilnehmer*innen büssen.
Friedlich demonstriert und verurteilt
Was das in der Praxis bedeutet, weiss René* zu berichten. René ist jahrelang in der linken Szene aktiv, nimmt an unzähligen Kundgebungen teil. «Das erste Mal hörte ich von Landfriedensbruch an einer grösseren Demo», erzählt er. Man habe dort per Flyer darüber informiert, welche juristischen Konsequenzen die Teilnahme unter Umständen haben könne. «Ich war schon erstaunt, als ich las, dass ich auch dann verurteilt werden konnte, wenn ich mich selber völlig passiv verhielt.» Nach einer Demo im Jahr 2011 flatterte dann der erste Strafbefehl ins Haus. René zog ohne anwaltliche Vertretung vors Regionalgericht – und verlor. «Damals wurde mein Vertrauen in den Rechtsstaat grundlegend erschüttert», stellt er rückblickend fest.
«Gelingt es den Ermittlungsbehörden nicht, die der eigentlichen Gewalttätigkeiten Verdächtigen festzunehmen, so gestattet Art. 260 StGB eine stellvertretende Haftung ihres Umfelds.»
Ein Jahr später kommt es dann zu einem zweiten Zwischenfall. An einer Anti-WEF-Demo formiert sich bei der Reitschule ein Demonstrationszug, dem auch René angehört. Die Stimmung ist zwar angeheizt, doch Gewalttätigkeiten gibt es keine. Als der Zug die Schützenmatte verlässt, um via Bollwerk zur Heiliggeistkirche zu marschieren, wird er blitzschnell von einer gepanzerten Hundertschaft der Polizei und mehreren Gitterwagen eingekesselt. Irgendjemand wirft kurz nach der Einkesselung eine bereits auf der Schützenmatte gezündete Leuchtfackel in Richtung der Polizei. Die Leuchtfackel fällt mehrere Meter vor den Beamten und Beamtinnen zu Boden. Ein Einsatzleiter der Polizei spricht durch ein Megaphon zur umstellten Menge. Der Gemeinderat habe diese Demonstration nicht bewilligt, es würden deshalb alle Teilnehmer*innen einer Personenkontrolle unterzogen. Auch die Demoleitung wendet sich per Lautsprecher an die Demonstrierenden. Sie kritisieren das harsche Vorgehen der Polizei, zumal die Demo ja friedlich verlaufe, und bittet alle, Ruhe zu bewahren. Wohl aus Angst beginnen einige Personen vermeintliches Beweismaterial wie Handschuhe oder Vermummungsmaterial zu verbrennen und in Senklöchern zu entsorgen. «Daraufhin stürmte ein Kommando der Polizei mit Schlagstöcken in die Menge und zerrte mehrere dieser Personen aus dem Zug heraus», erinnert sich René. Trotz der Bedrohlichkeit der Lage behält er die Fassung und versucht, andere Teilnehmer*innen zu beruhigen. Es ist schliesslich nicht sein erster Kontakt mit der Polizei.
Dennoch ist René erstaunt, als Wochen später wieder ein Schreiben der Staatsanwaltschaft im Briefkasten liegt. Er habe sich des Landfriedensbruchs strafbar gemacht und werde deshalb zu einer Busse verurteilt, heisst es dort. Ausschlaggebend war die Leuchtfackel, die jemand in Richtung der Polizei schleuderte. Die Staatsanwaltschaft erblickt darin eine aus der Masse begangene Gewalttätigkeit – und erkennt auf Landfriedensbruch für alle Teilnehmer*innen der Demonstration. Wie schon vor einem Jahr will sich René die Anschuldigung nicht gefallen lassen. Er ist überzeugt, nichts Falsches getan zu haben, und erhebt Einsprache. Doch das Regionalgericht stellt sich auf die Seite der Behörde. René muss eine Busse und die Verfahrenskosten zahlen.
Die Strafbarkeit vorverlagert
Eine andere Person, die ebenfalls mit René im Demonstrationszug war, liess nicht locker und zog den Fall bis vors Bundesgericht. Doch auch dort unterlag sie mit ihrer Forderung nach Freispruch. Wer einen derart gefährlichen Gegenstand wie eine Leuchtfackel gezielt auf Menschen werfe, könne nicht drauf vertrauen, es werde zu keiner Beeinträchtigung der körperlichen Integrität kommen, heisst es im Urteil. Ausserdem sei bei einer solchen Veranstaltung damit zu rechnen, dass es zu Gewalttätigkeiten komme. Deshalb sei es auch nicht problematisch, dass die eingekesselten Personen den Demonstrationszug gar nicht mehr verlassen konnten, als die vermeidliche Gewalttätigkeit verübt wurde.
Damit war ein Präzedenzfall geschaffen, der auch in der Rechtslehre diskutiert wurde. In einem Artikel in der Fachzeitschrift «forumpoenale» stellte der Basler Strafrechtsprofessor Wolfgang Wohlers in Frage, ob ein Fackelwurf, der nicht trifft, überhaupt als Gewalttätigkeit einzustufen sei. Er kommt zum Schluss, dass der Fackelwurf allenfalls dann als Gewalttätigkeit einzustufen sei, wenn die Polizeikräfte genötigt worden wären, vor der brennenden Fackel zurückzuweichen. Besonders scharf kritisiert Wohlers die Annahme, dass bei einer solchen Demonstration stets mit Fackelwürfen und anderen Gewalttätigkeiten zu rechnen sei. «Strafbar ist nicht mehr die Teilnahme an einer Zusammenrottung, aus der heraus Gewalttätigkeiten begangen werden; strafbar ist nun vielmehr das Hineinbegeben in eine Menge, in dem Wissen, dass diese möglicherweise von Polizeikräften eingekesselt wird und es dann möglicherweise in einer Situation zu Gewalttätigkeiten kommt, in der man sich nicht mehr ohne Weiteres aus der Menge entfernen kann», hält er fest. Das habe mit geltendem Recht nicht mehr viel zu tun.
Im Sinn Greteners
Bei all dem ist letztlich die Beweisnot der grösste gemeinsame Nenner. Wie es Gretener 1895 unter dem Eindruck des Käfigturmkrawalles gefordert hatte, entstand mit dem Landfriedensbruch ein Tatbestand, den die Strafjustiz ohne nennenswerten Aufwand auch auf grosse Personenmassen anwenden kann. Das garantieren der konturlose Tatbestand und dessen exzessive Dehnung durch die Behörden.
Die derzeitige Auslegung des Landfriedensbruchs hat mit geltendem Recht nicht mehr viel zu tun.
Er überlege es sich seit seinen Verurteilungen zweimal, ob er an einer Kundgebung teilnehme, sagt René. Er hat bereits zwei Einträge im Strafregister und will sich nicht die berufliche Zukunft verbauen. Wäre die vom Ständerat geforderte Mindeststrafe bereits Tatsache, hätte René schon mindestens eine Gefängnisstrafe absitzen müssen. Dafür, dass er auf die Strasse ging und nichts gemacht hat.
*Name geändert
Eines vorweg: Jede Gewalt an Demonstrationen ist zu verurteilen, jene vonseiten der Polizei ebenso wie jene vonseiten der Demonstrierenden. Menschen, die bereit sind, Gewalt als alltägliches Mittel zur Repression oder zur Durchsetzung politischer Ziele einzusetzen, sollen bestraft werden. Aber eben nur sie. Wer mit friedlicher Absicht von durch Meinungs- und Versammlungsfreiheit geschützten demokratischen Instrumenten Gebrauch macht, darf in einem Rechtsstaat keine Sanktionen befürchten müssen. Insbesondere vermag das Problem der Beweisnot an Massenveranstaltungen den Landfriedensbruch nicht zu rechtfertigen. Die gesetzgeberische Ignoranz, die sich einerseits in der Beständigkeit des Landfriedensbruchs seit nun schon 76 Jahren und andererseits in der geplanten Verschärfung der Mindeststrafe manifestiert, zeugt von einem eingeschränkten Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis im Parlament. Besonders enttäuschend ist auch die Rolle des Bundesgerichts, das sich dieser legislativen Verfehlung nicht entgegenstellt, sondern die Anforderungen für eine Verurteilung gar weiter herabsetzte. Dabei wies die Rechtslehre in der Vergangenheit unzählige Male auf die offenkundigen Probleme im Zusammenhang mit dem Landfriedensbruch hin. Einige davon wurden im Artikel genannt, andere nicht. Zum Beispiel die Diskriminierung einer Art des politischen Aktivismus. Der Landfriedensbruch richtet sich nur gegen eine bestimmte Bevölkerungsklasse, nämlich gegen jene, die sich nicht durch den Einsatz finanzieller Mittel politisches Gehör verschaffen können, und eignet sich deshalb, unliebsame Oppositionelle klein zu halten. Das ist aus staatspolitischer Perspektive heikel. «Der Tatbestand ist mir schon deshalb unsympathisch», antwortete Emil Zürcher, Professor für Strafrecht, als man ihn 1895 in der Expertenkommission nach seiner Meinung zu Greteners Vorstoss fragte. Dem schliesse ich mich an.
– Yannic Schmezer