Wer bleibt, zahlt
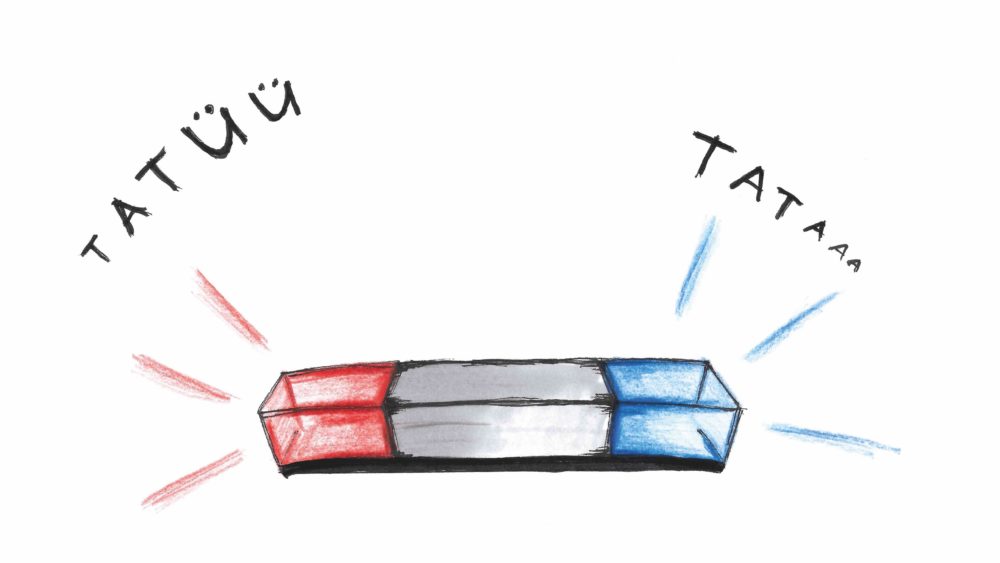
Im Januar bespricht der bernische Grosse Rat die Totalrevision des kantonalen Polizeigesetzes. Nebst einer Ausweitung polizeilicher Kompetenzen sieht das Gesetz Grundlagen für die Kostenüberwälzung auf Veranstaltende und Teilnehmende von Kundgebungen und VerursacherInnen von Polizeieinsätzen vor. Es drohen Einschnitte in die Grundrechte.
Das aktuelle Polizeigesetz des Kantons Bern stammt aus dem Jahr 1997 und erfuhr vor zehn Jahren seine letzte grössere Teilrevision. Im Jahr 2013 sollte eine weitere dazukommen, diese wurde jedoch zu Gunsten der Totalrevision gestoppt, die der Grosse Rat im Januar besprechen wird. Nach 20 Jahren soll das Polizeigesetz also komplett überarbeitet werden, um es den heutigen Anforderungen und Problemen der Polizeiarbeit anzupassen sowie Klarheiten zu schaffen, wo in der Vergangenheit Unsicherheit herrschte. Beim ersten Augenschein fällt zunächst auf, dass der Gesetzestext gehörig an Inhalt dazugewonnen hat: Aus den 66 Artikeln im geltenden Gesetz wurden in der Totalrevision 189. Doch mehr Inhalt bedeutet in diesem Fall nicht mehr Klarheit. Im Gegenteil: Die Totalrevision führte zu einer Vielzahl neuer Bestimmungen, die mit ihrem Wortlaut mehr Verwirrung stiften als Erkenntnis schaffen.
Vollbart und nahöstliche Kleidung
Eine auffallende Tendenz der Gesetzesüberarbeitung besteht darin, dass die Kantonspolizei mit mehr Kompetenzen zur Ermittlung ohne vorliegende Straftat (Vorermittlung) ausgestattet wird. So kann die staatliche Strafverfolgungsbehörde laut Artikel 111 des neuen Polizeigesetzes «zur Erkennung und Verhinderung von Verbrechen oder Vergehen» einen Monat lang ohne richterlichen Beschluss verdeckt fahnden. Konkret heisst das, die Kantonspolizei kann auf Verdacht gegen eine Person ermitteln ohne die Verpflichtung, sich als Vollstreckerin der Staatsgewalt erkennen zu geben.
«In Zeiten des Terrors haben es solch einschneidende Massnahmen besonders leicht»
Was der Artikel hingegen nicht regelt ist, wie begründet der Verdacht sein muss, damit die Polizei verdeckt fahnden kann. Dem Regierungsrat und Vorsteher der Polizei- und Militärdirektion, Hans-Jürg Käser, zufolge kann dazu keine genaue Definition gegeben werden. Die Anordnung einer verdeckten Fahndung liege im Ermessensspielraum der jeweiligen Einsatzleitung und sei von Fall zu Fall unterschiedlich zu bewerten. «Manchmal gibt es Gerüchte, die von unterschiedlichen Quellen mehrmals genannt werden und die durch Beobachtungen zusätzlich untermauert werden», sagt der Freisinnige und zeichnet das Bild eines jungen Mannes, der durch das Tragen eines Vollbartes und nahöstlicher Kleidung auffällig wird.
Ausweitung bestehender Massnahmen
Der Artikel stelle eine massive Ausweitung des Anwendungsbereiches polizeilicher Massnahmen dar, sagt Simone Machado, Grossrätin der grün-alternativen Partei und Mitglied der Sicherheitskommission. Für Regierungsrat Käser hingegen stützt sich der Artikel klar auf die Strafprozessordnung. Diese regelt jedoch nur die verdeckte Fahndung und die verdeckte Ermittlung zur Verfolgung von Straftaten. Das neue Polizeigesetz weitet mit dem Begriff der Vorermittlung die Strafprozessordnung tatsächlich aus. Derselbe Passus findet sich auch in Artikel 118, der die Observation regelt. Auch hier kann die Polizei bereits zur Erkennung von Straftaten aktiv werden, sofern «ernsthafte Anzeichen» dafür bestehen. Wieder stellt sich die Frage, wie ernsthaft können und müssen diese Anzeichen sein, damit sie die Überwachung einer Person rechtfertigen? Für die Juristin Machado ist klar: «Indizien müssen manifest sein.» Gerüchte und Mutmassungen würden dazu nicht ausreichen.
Technische Hilfsmittel der Zukunft
Neben den Voraussetzungen für eine polizeiliche Observation regelt Artikel 118 zudem den Einsatz von technischen Hilfsmitteln zu diesem Zweck. Erlaubt sind laut Absatz 2 des besagten Artikels Überwachungsgeräte, «um den Standort von Personen oder Sachen festzustellen.» Worum es sich dabei genau handelt, erläutert der Botschaft des Regierungsrates zum neuen Gesetz: «Gemeint sind beispielsweise GPS-Geräte, mit denen Standorte eruiert werden können.» Ferner rechtfertige der Einsatz technischer Hilfsmittel keine Überwachung der Post- und Fernmeldeverkehrs. Eine Eingrenzung des Begriffs «Überwachungsgeräte», die im Gesetzestext selber fehlt. «Wir wollen keine technischen Spezifikationen namentlich im Gesetz erwähnen», gibt Käser zu bedenken, schliesslich wisse niemand, welche technischen Neuerungen die Zukunft bringe. Dennoch bleibt es fraglich, weshalb der Artikel die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr nicht konkret ausschliesst, wenn dies von Beginn weg die Absicht war.
Freiheit oder Sicherheit?
Generell schafft der Gesetzesentwurf Klarheit darüber, was die Kantonspolizei tun darf und kann, nicht hingegen dazu, wann sie diese Kompetenzen ausschöpfen darf, bzw. wann nicht. Gerade da, wo es darum geht, dass Grundrechte der BürgerInnen, wie zum Beispiel die Privatsphäre, eingeschränkt werden, mangelt es an präzisen Formulierungen. «In Zeiten des Terrors haben es solch einschneidende Massnahmen besonders leicht», meint Simone Machado. Für sie stünden jedoch die persönliche Würde und die Privatsphäre über dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Zumal die Massnahmen ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelten, denn deren Wirksamkeit sei nicht unumstritten. Deshalb fordert Machado eine öffentlich einsehbare Statistik, die verdeckte Fahndung, Vorermittlung und Observation erfasst und über deren Effektivität Auskunft gibt. Hans-Jürg Käser beteuert ebenfalls, dass ihm die Rechte der BürgerInnen am Herzen liegen: «Ich bin immer zurückhaltend, denn für mich ist die persönliche Freiheit ein hohes Gut. Ich bin kein Freund der Überwachung aller.» Deshalb seien die fraglichen Artikel als «Kann-Artikel» formuliert. Auf die dazugekommenen Kompetenzen der Polizei verzichten will Käser aber nicht, denn es solle möglich sein, einzuschreiten, bevor eine Straftat begangen werde. «Sonst werden wir nach einem Terroranschlag vorwurfsvoll gefragt, warum wir vom Täter nichts gewusst haben.»

Die Kosten verteilen
Neben dem Ausbau polizeilicher Kompetenzen finden sich im neuen Polizeigesetz zahlreiche Bestimmungen, die für unterschiedliche Situationen regeln, wer die Kosten des Polizeieinsatzes zu tragen hat. Die meisten davon betreffen das Verhältnis zwischen der Polizei und den Gemeinden – denn als 2007 die Stadtpolizeien in die kantonale Einheitspolizei überführt wurden, entstand zwischen Gemeinden und Kantonspolizei eine Art Dienstleistungsverhältnis. Die Gemeinden kauften fortan polizeiliche Leistungen beim Kanton ein. Heute bezahlt folglich die Allgemeinheit, vermittelt über kommunale und kantonale Steuern, für Polizeieinsätze. Das neue Polizeigesetz rüttelt jedoch an diesem Grundsatz. Den Boden dafür ebnen zwei Normen, die vier Dutzend Artikel auseinanderliegen, deren Kernen aber die gleiche Idee innewohnt: Personen, die einen Polizeieinsatz verursachen, sollen in Zukunft unter gewissen Umständen die Kosten dafür tragen.
Den würzigen Fonds bildet Artikel 137, der unter dem Titel «Verrechnung polizeilicher Leistungen» steht. Demnach kann die Kantonspolizei für erbrachte Leistungen von den StörerInnen bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit Kostenersatz verlangen. Dasselbe gilt für VerursacherInnen von besonderem Aufwand, sofern sie oder er grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Eine sperrige Norm in fünf Punkten, die noch weitere Fälle vorsieht. Interessant sind aber vor allem die beiden obengenannten, also jene der störenden oder verursachenden Person. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen den beiden: StörerIn ist, wer die öffentliche Ordnung unmittelbar stört oder gefährdet. VerursacherInnen hingegen treten nicht selber störend auf, verursachen aber trotzdem einen Polizeieinsatz. Zu denken ist etwa an eine Wandergruppe, die sich verirrt und so eine aufwändige Suchaktion mit Helikoptern, Wärmebildkamera und Handyortung auslöst.
Die Polizei bestimmt
Ist es gerecht, einer Person die Kosten für den von ihr ausgelösten Polizeieinsatz zu verrechnen? Mit dem Verursacherprinzip, das dem Umweltrecht entlehnt ist, lässt sich argumentieren, dass die Kosten tragen soll, wer sie verursacht hat. In der Botschaft zum Gesetz schreibt der Regierungsrat, dass es nicht ersichtlich sei, weshalb die Allgemeinheit in jedem Fall für das Verhalten einer Einzelperson aufzukommen habe.
Das Argument geht scheinbar auf: Wer den Einsatz verursacht, bezahlt den Einsatz, so einfach. Trotzdem haftet dem Argument ein Mief an: Erstens wird damit die Solidarität in der Kostentragung durchbrochen. Die Polizei gehört zum Service Public und stellt somit die Rechnung nicht dem Individuum aus, sondern der Gemeinschaft. Artikel 137 höhlt dieses Prinzip aus. Zweitens entsteht bei der Kostenüberwälzung eine seltsame Konstellation: «Die Polizei bestimmt alles», sagt Simone Machado und führt weiter aus: «Sie bestimmt, wie gross ihr Einsatz wird und wem die Kosten dafür auferlegt werden». Am Ende hätten die Kostentragenden kaum Einfluss darauf, wie hoch die Kosten ausfielen, so Machado. Hinzu kommt, dass mit der juristischen Figur des sogenannten Zweckveranlassers die Kausalkette zwischen Ursache und Störung ausgedehnt werden kann. Dadurch wird die Rechtsfolge im Einzelfall schwer abschätzbar. Zweckveranlasser sind gemäss der Botschaft des Regierungsrats Personen, «die durch ein Tun oder Unterlassen bewirken oder in Kauf nehmen, dass Dritte die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden.» Die Botschaft macht dazu ein Beispiel: Jemand gestaltet eine Ausstellung in einem Schaufenster. In der Folge versammeln sich vor dem Schaufenster viele Personen, die schliesslich die Strasse blockieren und so einen Polizeieinsatz auslösen. Die Ausstellerin kann gemäss dem neuen Gesetz hierfür zur Kasse gebeten werden.
Bewilligungsauflagen als finanzielle Hürde?
Das in Artikel 137 statuierte Verursacherprinzip findet noch in einer weiteren Regelung Ausdruck. Konkret geht es um den Artikel 54 und die folgenden. «Im Rat wird es jene geben, die ihn als ‹Reitschul-Artikel› betiteln werden», sagt Hans-Jürg Käser. Artikel 54 sieht vor, dass die Kosten für Polizeieinsätze an Veranstaltungen, bei denen Gewalt an Personen oder Sachen verübt worden ist, den Veranstaltenden angelastet werden können, jedoch nur dann, wenn diese entweder keine Bewilligung einholen oder Bewilligungsauflagen grobfahrlässig verletzen. «Grundsätzlich bin ich der Auffassung, nicht nur als Polizeidirektor, sondern auch als Bürger,», sagt Käser und fährt fort, «dass Veranstalterinnen und Veranstalter, die wider besseren Wissens keine Bewilligung einholen, die Verantwortung für allfällige Gewalttätigkeiten tragen sollen».

Nur ist es nicht immer möglich, diese Verantwortung überhaupt erst wahrzunehmen. VeranstalterInnen einer Demonstration, die nicht genügend finanzielle Mittel haben, um Bewilligungsauflagen zu erfüllen, werden so aus der Öffentlichkeit verdrängt. Dass die Erfüllung solcher Auflagen teuer sein kann, bestätigt die Botschaft des Regierungsrats: Als Beispiele nennt sie die Auflage, einen Sicherheitsdienst zu organisieren oder das Vermummungsverbot an einer Demonstration durchzusetzen. Käser jedoch dementiert: In seiner Zeit als Regierungsrat habe er noch nie den Eindruck gehabt, dass eine Demo aufgrund finanzieller Mittellosigkeit seitens Veranstalter nicht durchgeführt werden konnte. Natürlich dürfe es nicht sein, dass sich nur noch die Hochfinanz leisten könne, Veranstaltungen durchzuführen. Trotzdem lehne er es ab, dass der Staat, zum Zweck der Erfüllung von Bewilligungsauflagen, die Veranstalterinnen finanziell unterstütze. «Ich bin ein Freisinniger, ich glaube nicht, dass der Staat hierfür Finanzen ausrichten sollte», fügt Käser an.
Noch ein Kann-Artikel
Neben der Veranstalterin kann gemäss dem neuen Gesetz auch der Teilnehmer kostenpflichtig werden, wenn er selber Gewalt an Personen oder Sachen ausübt oder dazu aufruft. «Vielleicht bin ich zu einseitig auf der Ebene der Behörden, aber ich sehe nicht, weshalb eine politische Botschaft von Gewalt begleitet sein muss», sagt Käser.
Was bleibt, ist Rechtsunsicherheit. Die Unsicherheit darüber, was einen erwartet, wenn man sich nach Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes an eine Demonstration begibt.
Jedoch erschöpft sich die Kostenüberwälzung nicht in der Inpflichtnahme der Teilnehmenden, welche selbst Gewalt verübt haben. Zwar werden gemäss Artikel 55 Abs. 2 an gewalttätigen Veranstaltungen teilnehmende Personen, die sich auf behördliche Aufforderung hin entfernen, nicht kostenpflichtig, sofern sie weder selbst Gewalt angewendet noch dazu aufgerufen haben. In der Botschaft des Regierungsrats findet sich jedoch eine frappierende Präzisierung: Personen, die trotz Aufforderung der Polizei bleiben, können zur Kasse gebeten werden, selbst wenn sie keine Gewalt ausgeübt haben.
In der Botschaft wird argumentiert, dass sich diese Personen den Vorsatz der Gewalttäterinnen und Gewalttäter zu eigen machten und ausserdem zusätzlich polizeilichen Aufwand verursachten. Käser widerspricht: Nach seiner Meinung sollte bei den zurückbleibenden Personen unterschieden werden zwischen jenen, die Gewalt angewendet haben, und jenen, die keine Gewalt angewendet haben. Schlussendlich gelte immer der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Ausserdem sei auch diese Regelung als «Kann-Artikel» formuliert, die Kantonspolizei könne folglich Augenmass walten lassen und müsse nicht zwingend die Kosten verteilen. Er glaube deshalb nicht, dass diese Bestimmung zum Problem werde. Simone Machado ist anderer Meinung. Diese Norm laste denen, die sich nicht entfernten, die Verfehlungen anderer Leute an. Das sei nicht rechtfertigbar.
Chilling Effect
Was bleibt, ist Rechtsunsicherheit. Die Unsicherheit darüber, was einen erwartet, wenn man sich nach Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes an eine Demonstration begibt. Dabei ist der Einsatz hoch: Bis zu 30’000 Franken können einer Einzelperson in schweren Fällen verrechnet werden. Was genau ein schwerer Fall ist, darüber schweigt das Gesetz und auch andere Rechtsbegriffe bleiben nebulös: So ist zum Beispiel nicht klar, ab wann von Gewalt an Personen oder Sachen gesprochen werden kann. Muss dazu eine Straftat, also mindestens eine Sachbeschädigung oder eine Körperverletzung verübt worden sein, oder reicht es bereits, wenn Wände mit Kreide beschmiert wurden?

Klar ist aber auch, dass die Formulierung solcher Normen immer eine Gratwanderung darstellt. Polizeigesetze sind oft Rechtsgrundlagen in sehr delikaten Situationen. Sie müssen es den Polizisten und Polizistinnen erlauben, den Umständen entsprechend und oft auch rasch zu handeln und gleichzeitig eine genügend hohe Dichte aufweisen, damit Betroffene die Folgen ihres Verhaltens abschätzen können und dabei nicht übermässig in ihren Grundrechten beschränkt werden. Keine einfache Aufgabe also.
Trotzdem oder gerade deshalb droht der sogenannte «Chilling Effect». Dabei handelt es sich um einen Begriff, den das Bundesgericht verwendet, wenn sich Personen aufgrund der Befürchtung, sie könnte eine gewisse Rechtsfolge treffen, selber in ihren Grundrechten beschränken. Eine Art Abschreckungseffekt also, der im Fall der oben besprochenen Regelungen dazu führen könnte, dass Personen nicht mehr an Demonstrationen teilnehmen, weil sie sich vor den Kostenfolgen fürchten. So würden sie sich faktisch ihres Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit enteignen. Erst kürzlich setzte sich das Bundesgericht mit dem Luzerner Polizeigesetz auseinander, das bezüglich der Kostentragung an gewalttätigen Veranstaltungen eine dem neuen Berner Polizeigesetz sehr ähnliche Regelung getroffen hatte. In seinem Entscheid anerkannte das Bundesgericht grundsätzlich, dass die hohen Kostenfolgen (auch im Luzerner Gesetz galt eine Kostendecke von 30’000 Franken) kombiniert mit den offenen Formulierungen, die viel Interpretationsspielraum lassen, grundsätzlich einen Abschreckungseffekt bewirken könnten. Leider ging das Gericht in der Folge nicht näher auf die Problematik ein, sodass die Rechtslage weiterhin ungeklärt ist.
Fast schon beschlossene Sache
Ob die Regelung einen Abschreckungseffekt bewirkte, wäre schwer messbar. Zumal Personen, die eine Veranstaltung aus Angst vor Kostenfolgen mieden, ja gerade nicht in Erscheinung träten und sich so der Messbarkeit entzögen. Allenfalls würden Vergleichswerte vergangener, ähnlicher Veranstaltungen helfen, einen Referenzpunkt zu schaffen. Ob aber überhaupt Anstrengungen unternommen würden, einen Chilling Effect zu erfassen, steht in den Sternen.
Klar ist aber auch, dass die Formulierung solcher Normen immer eine Gratwanderung darstellt. Polizeigesetze sind oft Rechtsgrundlagen in sehr delikaten Situationen.
Das Polizeigesetz hätte eigentlich schon während der diesjährigen Novembersession vom Grossen Rat diskutiert werden sollen. Die Besprechung wurde dann aber kurzerhand auf Januar verschoben. Online sind die zahlreichen Änderungsanträge einzusehen, mit denen sich der Grosse Rat auseinandersetzen wird: Betreffend der in diesem Text besprochenen Artikel beantragt Machado für fast alle die ersatzlose Streichung, namentlich für die verdeckte Vorermittlung, für die Observation und für das Verursacherprinzip nach Artikel 137. Auch die Regelung zur Kostentragung an gewalttätigen Veranstaltungen wird frontal attackiert: Die SP-JUSO-PSA Fraktion verlangt die ersatzlose Streichung, in jedem Fall will sie aber mindestens höhere Hürden für die Kostenüberwälzung. Auch sollen Personen, die sich nicht an den Gewalttätigkeiten beteiligt haben, keine Kosten tragen müssen.
Die Chancen, dass die Anträge durchdringen, stehen jedoch schlecht. Das weiss auch Machado. Die Revision des Gesetzes ist nötig, das Parlament bürgerlich. Trotzdem müsse man auch solche Anträge vorbringen, findet Machado. Ihr Lohn bestehe schlussendlich darin, gehört zu werden und nicht selten sei es tatsächlich still im Saal, wenn sie spreche. Doch ist in dieser Sache die Stille für einmal keine gute Währung. Stattdessen müssten mehr ParlamentarierInnen den Mund aufmachen. Ansonsten obsiegt der Status Quo in den Köpfen – und der steht derzeit auf der vorbehaltlosen Annahme der Revision.






