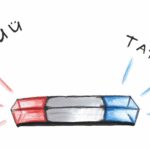Nachwuchs für den blauen Block

Auf dem Stundenplan steht Strassenverkehrsrecht - eine Mischung aus theoretischer Fahrprüfung und Jurastudium.
Wer zur Polizei will, muss zuerst für ein Ausbildungsjahr in die Innerschweiz. An der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch werden die zukünftigen GesetzeshüterInnen aus elf Kantonen ausgebildet. Für ihre Zukunft in Uniform üben hier jährlich bis zu 300 AspirantInnen den Umgang mit Seifenmunition, unnachsichtigen NachbarInnen und der berufsbedingten Machtposition.
«Nehmen wir an, die Grenze zur Gesetzesüberschreitung wäre eine rote Linie und der Verbrecher steht hier auf dieser Seite der Linie.» Roland Steiner zeichnet mit dem Zeigefinger eine unsichtbare Linie auf den Boden und deutet auf einen Punkt links daneben. «So steht der ideale Polizist direkt neben ihm auf der anderen Seite der Linie. Ein richtig guter Polizist besitzt dasselbe Denken wie ein Verbrecher. Aber er weiss, wo die Grenze ist.» Steiner selbst bezeichnet sich eher als klassischen Polizisten. Dieser sei immer aufmerksam, immer suchend, versuche stets mitzukriegen, was um ihn herum abgehe. Deshalb werde er aber in der Verbrecherwelt auch sofort erkannt. Die Gefahr beim idealen Polizisten sei, dass es ihn einmal «kehren» wird: Er wird zum Verbrecher. «Auch das hat es schon gegeben.»
Steiner leitet die Grundausbildung der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch (IPH). In dieser kleinen Gemeinde im Luzerner Seetal werden seit 2007 die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten aus elf Kantonen der Zentral- und Nordwestschweiz ausgebildet, darunter auch die des Kantons Bern. Pro Jahr absolvieren zwischen 200 und 300 Aspirantinnen und Aspiranten die Polizeischule. Sie sollen auf ihre zukünftige Arbeit bei der Polizei vorbereitet werden, bei welcher laut Steiner das tägliche Ziel sei, «am Abend lebendig heimzukommen.»
«Möglichst alle guten Leute erwischen»
Wer in Hitzkirch die Polizeischule besucht, hat meist einen langwierigen Bewerbungsprozess hinter sich. Viele absolvierten anfänglich die Polizeiliche Anforderungsprüfung (PAP). An mehreren möglichen Terminen im Jahr werden die Kandidierenden auf Herz und Nieren geprüft. Psychologische Fragebögen, ein gesundheitlicher Check-Up und eine Deutschprüfung bilden die wichtigsten Teile des Tests. Aber auch eher ungewöhnliche Aspekte wie das Zehnfingersystem oder mögliche Phobien werden überprüft. «Rohdatengenerierung» nennt dies Steiner. Damit soll gewährleistet werden, dass sich alle KandidatInnen unter gleichen Bedingungen präsentieren dürfen. Die Anforderungsprüfungen in Hitzkirch finden meist am Wochenende statt, denn nur so könne garantiert werden, dass niemand Konsequenzen am Arbeitsplatz zu befürchten habe. ArbeitgeberInnen um einen freien Tag bitten zu müssen, damit man sich für einen anderen Job empfehlen kann, sei eine heikle Angelegenheit und solle für alle vermieden werden, so Steiner.
«Natürlich wissen wir, dass fürs Polizeiauto keine Busse ausgestellt wird, wenn das Parkticket nicht gelöst wurde. Denn wir sind ja diejenigen, die kontrollieren»
Den durch diese Anforderungsprüfungen erlangten Datensatz verarbeitet die IPH schliesslich zu einer Rangliste aller TeilnehmerInnen. Wer nach Abschluss der mathematischen Berechnungen zuoberst steht, gilt als die geeignetste Person für den Dienst in Blau. Steiner ist überzeugt vom Erfolgscharakter der zentralen Vorrekrutierung. «Um möglichst alle guten Leute zu erwischen, müssen viele Prüfungstage zur Rekrutierung zur Verfügung gestellt werden.» Von den elf Konkordatspartnern der IPH macht aber erst knapp die Hälfte der Kantone bei diesem Aufnahmeverfahren mit.
Polizeinachwuchs als Mangelware
Der Kanton Bern gehört zur anderen Hälfte der Kantone und geht in der Rekrutierung einen eigenen Weg. Er setzt auf eine dezentrale Anforderungsprüfung. Bei diesem Verfahren absolvieren die BewerberInnen die Tests direkt im Korps, für welches sie später arbeiten möchten. Um überhaupt in den Selektionierungsprozess aufgenommen zu werden, müssen sie gewisse Grundvoraussetzungen mit sich bringen. An einem Infoanlass orientiert das Berner Polizeikorps über seine Anforderungen an zukünftige PolizistInnen. Das Mindestalter von 21 Jahren und der Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft sind zentrale Bedingungen. Der Bewerber oder die Bewerberin sollten zusätzlich mindestens eine abgeschlossene B-Lehre vorweisen können, keinen Eintrag im Straf- und Betreibungsregister besitzen und Autofahren können. Militärdienstverweigerer sind nicht erwünscht und wer den Zivildienst absolviert hat, muss begründen, wieso er sich gegen den Dienst in der Armee entschieden hat. Das Korps erwartet von seinen zukünftigen PolizistInnen insbesondere auch sprachliche und körperliche Fitness. In ihrem Onlineauftritt warnt die Kantonspolizei davor, dass viele Bewerbende im Sporttest und an der Deutschprüfung scheitern. Eine gezielte Vorbereitung sei deshalb empfehlenswert, um die eigenen Erfolgschancen zu verbessern.

Für das Erproben von Ernstfällen wurde ein winziges Dörflein aufgebaut: zwei Mehrfamilienhäuser, ein EInfamilienhaus, eine Bank, eine Tankstelle.
Doch wie sieht es aus, wenn eine Person nicht alle der geforderten Anlagen besitzt? Wenn ein Bewerber schmächtig gebaut ist, dafür umso besser in den psychologischen Tests abschneidet? Wenn eine Kandidatin alle sonstigen Ansprüche erfüllt, aber nicht das Durchsetzungsvermögen besitzt, das erwartet wird? «Am Ende sind immer die Korps dafür verantwortlich, wer rekrutiert wird», sagt Steiner. Polizeinachwuchs ist vielerorts Mangelware. Der Druck, genügend neue AspirantInnen zu rekrutieren, führt dazu, dass die Regeln gelockert werden, um den Pool an potentiellen KandidatInnen zu vergrössern. Da wird dann auch mal jemand genommen, der die Grundbedingungen nicht allesamt erfüllt. Diese Entwicklung bemerken auch die Verantwortlichen in Hitzkirch. Ausbildungschef Steiner spricht von einem offensichtlichen «Rekrutierungsproblem». Die Selektionskriterien seien von Korps zu Korps unterschiedlich, was sich in der Anzahl und Qualität der Rekrutierten niederschlage. Die Interkantonale Polizeischule als zentrale Ausbildungsstelle hat keine Entscheidungsmacht bezüglich der Tauglichkeit der Aspirierenden. Sofern sie Prüfungen bestehen und das Korps ihnen wohlgesinnt ist, können sie nicht rausgeworfen werden. Die Schule steht jedoch in engem Kontakt mit den Korps. In diesem Sinne werden auch regelmässige Rückmeldung oder Empfehlungen an die Ausbildungsverantwortlichen in den Korps übermittelt.
Die Krux des Vorbildseins
Das Klassenzimmer füllt sich, zum Schluss betritt der Lehrer den Raum und richtet sich vorne am Pult ein. Die Laptops werden aufgeklappt, Trinkflaschen auf die Pulte gestellt. Ein Aspirant ordnet die Magnete an der Wandtafel und kehrt dann an den Platz zurück. Langsam verstummen die Gespräche, die Schülerinnen und Schüler erheben sich, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ein Aspirant zählt die Anwesenden und meldet die Klasse als komplett. Der Lehrer bedankt sich und teilt mit, dass die Korps sich gewünscht hätten, dass in der Schule noch einmal Theorie und Praxis des Automobillenkens thematisiert würden. In der darauffolgenden Woche werden deshalb alle Aspirantinnen und Aspiranten mit einem Experten eine Fahrt absolvieren. Der Rückmeldungsbericht dieser Fahrt wird an die Korps geschickt.
Danach beginnt der offizielle Unterricht. Strassenverkehrsrecht steht auf dem Stundenplan – eine Mischung aus Theoretischer Führerprüfung und Jurastudium. Mit Nachdruck wird die gesellschaftliche Vorbildposition hochgehalten. Der Mensch in Uniform stehe in der Öffentlichkeit nämlich unter ständiger Beobachtung. «Natürlich wissen wir, dass fürs Polizeiauto keine Busse ausgestellt wird, wenn das Parkticket nicht gelöst wurde. Denn wir sind ja diejenigen, die kontrollieren», meint der Lehrer. Trotzdem sei die Polizei strenggenommen nicht vom Parkticketlösen befreit. «Wenn keine Dringlichkeit besteht, gilt für die Polizei jede Regel genauso wie für alle anderen.» Und zwar von Geschwindigkeitslimiten über die Respektierung des Vortritts für FussgängerInnen bis hin zu Parkverboten. Jede beobachtete Regelmissachtung, jede Ausnützung der berufsbedingten Machtfülle schade dem Bild der Polizei in der Bevölkerung und delegitimere die Position der Polizei. Dieser Aspekt greife auch in das Privatleben über. «Der Nachbar, der weiss, dass du ein Polizist bist, und dein Auto regelmässig im Parkverbot bemerkt, wird seine Bussen als scheinheilig empfinden.» Der besonderen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit müsse man sich als Mitglied der Polizei bewusst sein – keine einfache Aufgabe: «Mit diesem Druck muss man umzugehen lernen.»
Üben für den Ernstfall
Druck als zentrales Element des polizeilichen Alltags konstatiert auch die Ausbildungsbroschüre an der Polizeischule Hitzkirch: Im Polizeiberuf muss «schnell gehandelt und entschieden werden und manchmal geht es sogar um Leben und Tod». Dabei stehe der Dienst am Menschen und für das Gemeinwesen stets im Mittelpunkt. Auf diese komplexen und anspruchsvollen Strukturen der Polizeiarbeit sollen die Aspirantinnen und Aspiranten in der zehnmonatigen Grundausbildung vorbereitet werden. Mit einem Blick in den Rahmenlehrplan zeigt sich denn auch das breite Spektrum der Unterrichtsfächer. So findet man neben Recht, Verkehr und Sicherheit beispielsweise auch ein Fach mit dem Titel «Community Policing». Dieses soll die polizeiliche Nähe zur Bevölkerung fördern. Ziel ist es, durch den kommunikativen und präventiven Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinschaftliche Probleme zu lösen. Ein häufiger Fall für die Anwendung dieser Strategie sind beispielsweise Klagen über nachbarschaftlichen Lärm. Wenn die Lärmemissionen jedoch nicht die gesetzlichen Richtlinien übersteigen, könne das Problem nicht rechtlich geregelt werden. «In diesem Falle muss man mit den Leuten reden», so Steiner. «Die Kommunikationsfähigkeit muss heute in der Schule erlernt werden, früher ging man noch in die Beizen und fand so den Zugang zu den Leuten.»
«Die Armee zerstört, die Polizei stoppt.»
Richtig zur Sache geht es jeweils im Aabach, im praktischen Trainingscenter der Polizeischule. Die Fassade des Aabachs ist grau geblieben, die Reben, die das ganze Gebäude mit Grün bedecken sollten, sind nicht gewachsen. In seinem Innern befinden sich das Ausrüstungslager, das Waffenarsenal und die Schiesshalle. Für das Erproben von Ernstfällen wurde hier ein eigenes winziges Dörflein aufgebaut: zwei Mehrfamilienhäuser, ein Einfamilienhaus, eine Bank, eine Tankstelle. «In diesen Häusern könnte man wohnen», meint Steiner und dreht zum Beweis den Wasserhahn des Spülbeckens auf, er funktioniert. Die Betten sind bezogen, Pflanzen dekorieren das Wohnzimmer. Hier werden Einsatzszenarien durchgespielt, dafür muss alles so realistisch wie möglich eingerichtet sein. Während den Übungen schlüpfen einige AspirantInnen in die Rolle der Zivilbevölkerung, die anderen versuchen die theoretisch erlernte Taktik anzuwenden. Geschossen wird mit Seifenmunition, der Schmerz beim Getroffenwerden ist vergleichbar mit einem Paintballschuss. Geschossen werde im Einsatz aber nur im äussersten Notfall, bekräftigt Steiner, und dann auf die Beine. Dies sei der Unterschied zwischen der Armee und der Polizei: «Die Armee zerstört, die Polizei stoppt.»
Harmonisches Campusleben
«Einfach mal raus» wollte Tanja. Im letzten Jahr ihres Jus-Masterstudiums entschied sich die Siebenundzwanzigjährige dazu, Polizistin zu werden. «Ich wollte nicht jeden Tag im Büro und vor dem Computer sitzen, ich wollte Praxis.» Nun gehört sie zu jenen rund neunzig Aspirantinnen und Aspiranten, welche in diesem Oktober die Polizeiausbildung in Hitzkirch begannen. Ihre MitschülerInnen haben in den unterschiedlichsten Bereichen eine Ausbildung absolviert. PolymechanikerInnen, KV-AbsolventInnen, Berufsmilitärs oder PsychologiestudentInnen – sie alle finden in Hitzkirch zusammen. Da die Polizeischule eine Zweitausbildung sei, begründet Steiner, verdienen Aspirantinnen und Aspiranten während ihrer Ausbildung je nach Alter zwischen 4’000 und 5’000 Franken pro Monat. Wer die Ausbildung nach mehr als vier Monaten abbricht, die Berufsprüfung nicht besteht oder innerhalb von fünf Jahren zu einem anderen Kanton wechselt, untersteht deshalb einer sogenannten Rückzahlungspflicht von bis zu 12’000 Franken. In ihrem Lehrgang haben bereits drei Schülerinnen und Schüler abgebrochen, dies sind ungewöhnlich viele.
Tanja ist motiviert für die verbleibenden achteinhalb Monate. Zwar sind für sie die theoretischen Fächer etwas unterfordernd, dafür hätte sie beim Schiessen lieber noch mehr Zeit zum Üben. Aber das Schöne sei, dass man einander helfe. Trotz Druck herrsche ein freundschaftliches Klima untereinander. Zwei Drittel aller AspirantInnen wohnen unter der Woche auf dem Campus. Die Zimmer werden von der Schule allen, welche ansonsten mehr als eine Autostunde Schulweg zurücklegen müssten, gratis zur Verfügung gestellt. Das Campusleben schweisse zusammen, antworten die Befragten einstimmig. Nach der Schule gehe man zusammen spörtlen oder etwas trinken. «Ab dem zweiten Semester vergeben wir auch Doppelzimmer», meint Steiner augenzwinkernd.