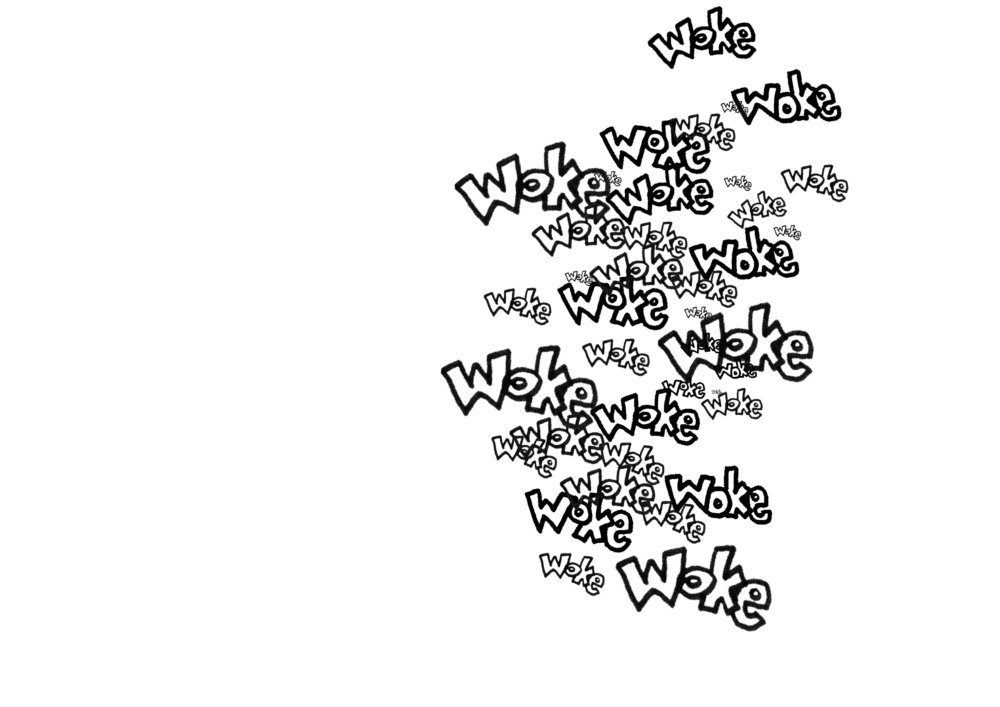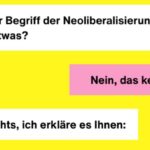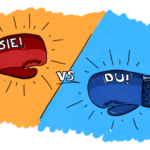Woke Wissenschaft – Was ist denn das?

Gewisse Forschungsrichtungen stehen aktuell stark in der Kritik. Sie werden mit Ideologie und politischem Aktivismus gleichgesetzt und als unwissenschaftlich bezeichnet. Dieser Beitrag spürt dem medialen Diskurs nach und fragt: Was hat es mit diesen Vorwürfen auf sich und wie berechtigt sind sie eigentlich?
Text: Mara Hofer
Fotos und Illustrationen: Mara Schaffner und Lisa Linder
Seit dem 7. Oktober 2023 stehen in der Schweizer Medienlandschaft bestimmte Forschungsrichtungen und Institute in der Kritik. An der Universität Basel wurde dem Fachbereich Critical Urban Studies Antisemitismus und Aktivismus vorgeworfen und in Bern wurden gegen das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften (ISNO) ähnliche Vorwürfe erhoben, nachdem ein Dozent aufgrund gewaltverherrlichender Tweets entlassen wurde. An beiden Universitäten gab es Untersuchungen und in beiden Untersuchungsberichten wurde vorgeschlagen, die betreffenden Einheiten in grössere Einheiten zu integrieren. In Bern informierte die Universitätsleitung im Februar an einer Pressekonferenz darüber, dass das ISNO in der aktuellen Form aufgelöst wird. Dies obwohl in den (beiden) Untersuchungen festgestellt wurde, dass wissenschaftliche Standards eingehalten worden waren.
Den betreffenden Forschungsrichtungen wurden in verschiedenen Medienbeiträgen Unwissenschaftlichkeit aufgrund von Einseitigkeit und Ideologie vorgeworfen. Angehörige der Forschungsrichtungen wurden als woke und politisch respektive aktivistisch bezeichnet. Dieses mediale Klima und die Reaktionen der Hochschulen führen bei Universitätsangehörigen teilweise zu Unverständnis und Sorgen. Vor allem aber steht fest: Das Thema polarisiert.
Die Kritik der Medien
Die Kritik der Medien richtet sich an Forschungsrichtungen, die sich mit Minderheiten und mit marginalisiertem Wissen auseinandersetzen – allen voran postkoloniale Theorien und Critical Race Theorien. So schreibt beispielsweise die NZZ:
«Die ‚critical race theory‘ ist weniger von wissenschaftlichen Standards geprägt als von Glaubenssätzen: Rassismus ist überall, lautet einer davon. Wer weiss ist, ist privilegiert, ein zweiter. Und weil die Strukturen der westlichen Gesellschaft von Weissen geprägt sind, ergibt sich daraus ganz zwanglos: Wer weiss ist, ist rassistisch.»
Auch Max, der am ISNO studiert und eigentlich anders heisst, kritisiert solche Haltungen. Er ist einer von vier Studierenden, die mir ihre Gedanken zur medialen Debatte mitgeteilt haben. Die postkoloniale Theorie sei als solche durchaus legitim, findet Max. Sie verkomme aber schnell zu Aktivismus, wenn Vertreter*innen der Theorie erklären würden, wir befänden uns in einer neokolonialen Welt, unterworfen von einer Dichotomie der Herrschenden und Beherrschten. «Solche Theorien halten keiner genaueren wissenschaftlichen Kritik stand. Dementsprechend müssen sich deren Vertreter hinter dem Aufschrei nach medialer Zensur verstecken», so Max.

Patricia Purtschert im Gespräch
Über diese Kritik habe ich mit Patricia Purtschert gesprochen. Sie ist Professorin für Geschlechterforschung und arbeitet seit vielen Jahren mit postkolonialen Theorien. «Leider stellen viele aktuelle Debatten die postkoloniale Forschung enorm verkürzt dar, manchmal richtiggehend als Karikatur wissenschaftlicher Forschung», meint Purtschert.
«Komplexe und differenzierte Analysen von kolonialen und postkolonialen Machtstrukturen, die von globaler Bedeutung sind und das Leben unzähliger Menschen betreffen, werden auf eine holzschnittartige Darstellung von böse und gut reduziert. Das hat nichts mit dem Stand der Forschung zu tun.»
Auch verschiedene Wissenschaftler*innen stellten sich im offenen Brief «Für die Wissenschaftsfreiheit in der Schweiz» gegen solche Darstellungen. Das Schreiben, welches im Februar veröffentlicht wurde, richtet sich an die Schweizer Hochschulen und bekundet Sorgen über ein «wissenschaftlich unhaltbares und politisiertes Medienframing» und über die Sanktionen, die durch den medialen Druck erfolgten. Michelle, eine Wissenschaftlerin an der Universität Bern, die in Wahrheit anders heisst, hat den Brief mitverfasst. Sie führt aus:
«Was in der medialen Kritik oft vergessen geht, ist, dass die Debatten, die wir führen, historisch gewachsen sind. Sie existieren in einem wissenschaftlich nachverfolgbaren Kontext.»
Wenn dieser Kontext Aussenstehenden nicht ersichtlich sei, könne dies schnell zu einer verkürzten Sicht auf die Forschungsrichtung führen. So auch im Bereich postkolonialer Studien. In einem Konferenzbeitrag, Artikel oder Uniseminar könne nicht immer ganz am Anfang begonnen und erklärt werden, dass Kolonialstrukturen gewisse Machtungleichheiten hergestellt oder verstärkt haben, die sich bis heute auf Minderheiten auswirken. «Das ist ein wissenschaftlicher Diskurs, der etabliert ist», so Michelle.
«Man würde auch nicht von einer Teilchenphysikerin erwarten, dass sie in jedem 15-minütigen Konferenzvortrag erklärt, was Elektronen sind. Und das wünschen wir uns auch für uns; dass die Rigorosität unserer wissenschaftlichen Standards anerkannt wird, ohne, dass wir immer ganz bei Null anfangen müssen.»
Zwischen Objektivität und Ideologie
Was qualitative Forschung im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich, wie beispielsweise gender studies oder critical race studies ausmache, sei ein Fokus auf soziale Ungleichheit, auf die Analyse von Machtstrukturen und deren Veränderungen, so Purtschert. Oft gehe es dabei auch um Fragen der Gerechtigkeit, Umverteilung und um die Stärkung von Menschenrechten, Partizipation und Demokratie. «Das heisst nicht, dass normative Fragen immer im Zentrum der Forschung stehen», erklärt die Professorin. «Aber sie sind mit ihr untrennbar verbunden.» Purtschert und Michelle sehen im Ideologievorwurf einen starken Zusammenhang mit dem transformativen Potential der sogenannt kritischen Wissenschaftstraditionen. «Unsere Forschungsrichtungen und Toolkits, um die Welt anzuschauen, rütteln am Status Quo», so Michelle.
«Es ist klar, dass das aneckt, das darf es durchaus auch. Aber in einem fairen Diskurs und nicht mit einer kompletten Delegitimierung von dem, was wir machen und unseren Methoden.»
Das Veränderungspotential liege manchmal in der Natur der Sache, findet auch Purtschert. Wenn man beispielsweise zu Menschenrechtsverletzungen oder zu Klimawandel forsche, sei es schwierig, nicht gleichzeitig einen Horizont mitzudenken, an dem eine Welt vorstellbar wird, in der die Menschenrechte eingehalten und wir fähig sind, auf den Klimawandel so zu reagieren, dass wir nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Dass dieser normative Horizont mitlaufe, sei eine Stärke dieser Wissenschaften aber gleichzeitig auch eine Schwierigkeit. Man müsse dabei immer wieder klären, wo die Grenzen zum Aktivismus und zur Politik liegen; das sei im übrigen eine Aufgabe, die sich der Wissenschaft immer und überall auf verschiedene Arten stelle.
Wichtig dabei ist die Unterscheidung zwischen einer deskriptiven und einer normativen Ausrichtung, also wann etwas beschrieben wird und wann eigene Normen angesetzt werden. «Diese Unterscheidung kann hilfreich sein», so Purtschert, aber sie ist immer auch künstlich:
«Auch wenn wir deskriptiv arbeiten, legen wir eigene Normen an. Das lässt sich nicht vermeiden, nur schon durch die Begriffe, die wir verwenden, läuft immer auch ein normativer und ein historisch und kulturell spezifischer Gehalt mit.»
Darum sei die Reflexion auf die Situiertheit des Wissens, wie sie beispielsweise in der feministischen Theorie schon seit langem betrieben wird, so hilfreich und wichtig – für jede Wissenschaft. Gemäss Donna Haraway, einer Wissenschaftlerin aus diesem Bereich, könne dadurch gar eine stärkere Objektivität erlangt werden, da reflektiert wird, woher man spricht und man sich bewusst ist, dass das eigene Wissen Grenzen hat, die man nur überwinden kann, wenn man anderes Wissen auch zulässt.
Es gibt also verschiedene Wissenschaftstraditionen, darunter auch solche, die normativ(er) ausgerichtet ist. Forschung, die Normativität explizit thematisiert, mit Ideologie gleichzusetzen, findet Purtschert deshalb zu kurz gegriffen. «In der Ethik beispielsweise werden normative Argumente gegeneinander abgewogen und man versucht, die Entscheidung für das eine oder andere zu begründen», verbildlicht Purtschert.
Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftskritik
Als Professorin im Bereich gender studies ist sich Patricia Purtschert einen verzerrten Blick auf ihren Forschungsbereich gewohnt. «Es gab immer wieder Stimmen, die behaupteten, gender studies seien nicht interessant oder keine richtige Wissenschaft. Anfänglich war es eher so, dass die Geschlechterforschung von solchen Gegner*innen nicht ernst genommen wurde. Die wissenschaftliche Abwertung erfolgte durch das Kleinmachen. Interessanterweise hat sich das in den letzten Jahren verändert und teilweise richtiggehend verkehrt. Anti-Gender-Akteur*innen behaupten nun, es gebe eine Gender-Lobby, die eine weltumspannende Gefahr darstelle, insbesondere für traditionelle Geschlechter- und Familienmodelle.» Ein solcher Ideologiebegriff, aktuell oft mit der Bezeichnung «woke» in Verbindung gebracht, werde in ihren Augen oftmals verwendet, um eine tatsächliche Auseinandersetzung mit den Forschungsfragen und -resultaten der gender studies zu vermeiden, so Purtschert.
«Wenn man mir als Wissenschaftlerin sagt, du betreibst Ideologie, muss die Person, die das behauptet, sich nicht mehr mit meinen Forschungsinhalten auseinandersetzen», fährt sie fort. «Deshalb sehe ich das als einen rhetorischen Kniff, einen Teil der Wissenschaft zu delegitimieren.» Besonders problematisch seien solch extreme Verzerrungen und Karikaturen von Wissenschaft, wenn sie medial an Einfluss gewinnen und sogar Einfluss nehmen könnten auf Personalentscheidungen, Umstrukturierungen oder die Verteilung von Forschungsgeldern, so Purtschert.
Dass es innerhalb des Wissenschaftssystems Veränderungen gibt, ist allerdings üblich. Neue Themen kommen auf, Institute oder Zentren werden geschaffen und andere aufgelöst. Dass über Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftsfreiheit diskutiert wird und dass diese immer wieder neu verhandelt werden, sei sinnvoll und produktiv, findet auch Purtschert. «Seit es Wissenschaft gibt, gibt es auch Wissenschaftskritik», so die Professorin. Zentral dabei sei jedoch, dass wir in der Wissenschaft eine Übereinkunft haben, dass es eine Pluralität von Methoden und Herangehensweisen gibt, die sich im besten Fall ergänzen können. Und dass wir uns bewusst sind, dass Wissenschaft ein System mit Regeln ist, die für Wissenschaftlichkeit sorgen, indem Theorien empirisch und/oder argumentativ belegt, nachvollziehbar und überprüfbar gemacht werden. Gegen die Idee, dass Wissenschaft bloss eine Meinung sei, gelte es diese zu verteidigen; aber nicht als einen Monolithen, sondern als ein breit aufgestelltes Feld, in dem Dissonanzen und Kritik möglich sind und auch Platz haben sollen.
Wissenschaft und Politik: Ein Spannungsfeld
Im Rahmen der medialen Diskussion über die Verstrickung der Wissenschaft mit politischem Aktivismus hat der Rektor der Universität Bern sich in einer Medienmitteilung folgendermassen positioniert: «Advocacy und politische Stellungnahmen haben an der Universität Bern keinen Platz.» Und gegenüber dem Bund meinte der Rektor, die Universität sei keine politische Institution.
Unter Studierenden, mit denen ich im Austausch war, sowie auch im Kollektiv der Wissenschaftler*innen, die den offenen Brief verfasst haben, sind die Aussagen auf Unverständnis gestossen. «Es ist sehr naiv zu behaupten, dass Wissenschaft nie politisch ist», so Michelle.
«Die Universität ist politisch! Aber es ist auch politisch, wenn man an der Universität Zürich ein Center for Economics in Society hat, das von der UBS gesponsert wird; nicht nur, wenn man sich in Seminaren über Unterdrückung unterhält.»
Auch Lukas, ein weiterer ISNO-Student, der eigentlich anders heisst, stösst sich an den Aussagen, unter anderem, da sie einen Widerspruch zu Handlungen der Universität selbst darstellen würden. «Die Universität Bern bezieht selbst ständig politisch Stellung, und zwar zurecht.» Die Universität feiere beispielsweise jährlich den internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) als Zeichen der Akzeptanz und Solidarität für queere Menschen und habe sich auch zum Ukrainekrieg positioniert.
Was an der Universität passiert, kann also nicht einfach von Politik losgelöst betrachtet werden. Auch Forschende und Forschungsprojekte können mit Politik zusammenhängen.
Forschung zu politischen Themen kann normativ oder deskriptiv ausgerichtet sein und die Position sowie auch die Haltung der forschenden Person können einen Einfluss auf die Forschung haben – insbesondere in den qualitativ vorgehenden, empirischen Forschungsrichtungen; beispielsweise durch die Fragestellung, den Fokus, den man setzt oder aufgrund der eigenen Positionalität und dem Zugang zum Feld. So findet auch Michelle, dass «eine gewisse politische Haltung, die ja auch nicht verhehlt wird, nicht bedeutet, dass die wissenschaftliche Arbeit weniger wichtig ist oder weniger fundiert.» Zentral dabei ist Transparenz. Dass Universitätsangehörige als Einzelpersonen eine politische Einstellung haben (und haben dürfen) heisst nicht, dass sie deshalb ihre Forschung normativ danach ausrichten. Und selbst wenn Forschung normativ ausgerichtet ist und nicht deskriptiv, heisst dies nicht, dass sie deshalb unwissenschaftlich ist. Der Unterschied zwischen Politik und Wissenschaft sei eine Frage der Haltung, so Patricia Purtschert.
«In der Politik geht es oft darum, andere zu überzeugen, um gemeinsam handlungsfähig zu werden. In der Wissenschaft geht es schon auch darum, eine Position zu vertreten, aber das Argumentieren bricht dabei idealerweise nicht ab – ich muss meine Position stets überdenken und verändern. Wenn die Begründung einer Position nicht haltbar ist, muss ich bereit sein, mich zu verschieben.»
Abgesehen davon ist die Universität als Institution auch ein inhärent politischer Ort. Sie verfügt über verschiedene Akteur*innen mit unterschiedlichen Interessen, es gibt Machtstrukturen, Verteilkämpfe und politische Strukturen wie Gremien, Stände, Legislative und Exekutive. An der Universität wird Hochschulpolitik betrieben, insbesondere durch die Studierenden. So können die Aussagen des Rektors je nachdem, was für ein Verständnis von Politik herangezogen wird, kontestiert werden. Eine Position, die so klar auf Depolitisierung abzielt, kann daher in direktem Zusammenhang mit den medialen Vorwürfen gestellt werden, die die Universität als zu politisch darstellten.
Umgang der Hochschulen mit medialem Druck
Den offenen Brief haben bislang über 500 Schweizer Akademiker*innen unterzeichnet und so ihre Unterstützung für die aufgeworfenen Punkte zum Ausdruck gebracht. Aber die Universität weist die Vorwürfe klar zurück. In einer Replik nimmt sie Stellung und betont, dass keine Erosion der Wissenschaftsfreiheit festgestellt werden könne und dass an der Universität Bern der offene und breite Diskurs und die Debatte hochgehalten werde. Die im Brief aufgeworfenen Probleme wurden als zu einseitig kritisiert und es wurde bemängelt, dass Professor*innen anonym unterschrieben haben.
Michelle allerdings versteht, dass manche lieber anonym unterzeichnet haben. Schliesslich möchte auch das Kollektiv der Verfasser*innen des Briefs anonym bleiben, so auch Michelle. Denn in den vergangenen Monaten haben weltweit verschiedene Wissenschaftler*innen ihre Stelle verloren, weil sie sich in der Debatte positioniert haben. Es sei verständlich, wenn man da nicht mit dem eigenen Namen hinstehen möchte, so Michelle. Statt mit reinem Unverständnis zu reagieren, müsse sich die Universität hier fragen, weshalb das so ist. Dass die Universitätsleitung auf die Zustellung des Briefs nicht mit einer direkten Kontaktaufnahme reagiert, geschweige denn zu einem Gespräch eingeladen hat, findet Michelle bedenklich.
Der Offene Brief kritisiert nebst dem ausbleibenden Dialog auch den fehlenden Schutz durch die Universität. Als Michelle am ersten Februar die Pressekonferenz online mitverfolgte, an welcher die Auflösung des ISNO kommuniziert wurde, verspürte sie Angst und einen Impuls zur Selbstzensur.
«Als Person, die auch empirische Forschung macht und publiziert, war meine erste Reaktion: Oh, ich will eigentlich so schnell nicht mehr öffentlich sprechen zu meinem Forschungsthema.»
Es sei hochproblematisch, dass man so Angst bekommen müsse, weil man sich vom eigenen Arbeitgeber nicht geschützt fühle. Dass sich viele nicht mehr trauen, sich öffentlich zu positionieren, sei besonders problematisch, da von Wissenschaftler*innen eine fundierte Positionierung ja durchaus gefordert werde.
Was sagen die Studierenden?
Über die ganze Debatte und die Rolle der Universität darin, habe ich mich auch mit Studierenden des ISNO ausgetauscht. Die Meinungen gehen auseinander: Während einige die mediale Berichterstattung einfach etwas plakativ fanden, gab es auch Stimmen, die den Eindruck hatten, das Institut und die an ihm getätigte Lehre seien unrechtmässig diskreditiert worden. Die Sorgen, die im offenen Brief aufgeworfen werden, teilen einige, andere wiederum können sie nicht nachvollziehen. «Wer wirklich Wissenschaft betreibt, fordert keine kategorische Deutungshoheit, sondern ist bereit, mit seinen Äusserungen und Theorien im intellektuellen Disput zu stehen», findet Max. «Nur Ansätze, die sich wiederholt gegen Kritik behaupten können, sind stichhaltig. Solche Debatten finden dabei nicht nur im ‘safe space’ der Universität statt, sondern auch im politischen und medialen Bewusstsein», führt er aus. Auch Dave, der in Wirklichkeit anders heisst, schliesst sich dem an.
«Zum offenen Diskurs gehört dazu, Leute mit gegensätzlichen Meinungen aufgrund anderer Ansätze, die logisch erklärbar sind, zu respektieren. Es gibt keinen Anspruch auf Widerspruchsfreiheit.»
Er findet, dass sich Journalist*innen sehr wohl sich in universitäre Diskussionen einbringen dürfen, da sie als Kontrollinstanz ein wichtiges demokratisches Instrument seien. Lukas hingegen ist der Meinung, die medialen Beiträge hätten zu wenig neutrale Distanz gewahrt und kaum konkrete Beispiele für die Vorwürfe vorbringen können. «Um aus dem Fokus der Medien zu gelangen und um die Bevölkerung zu beschwichtigen, ist das Institut zu einem Bauernopfer geworden», führt er aus.
Doch nicht nur die mediale Debatte, sondern auch der (unzureichende) Austausch innerhalb der Universität beschäftigt. Es fehle an Offenheit im Umgang mit den Ereignissen, so Max. Auch Lukas und Sara, eine weitere Studentin, die eigentlich anders heisst, hätten sich mehr Räume für Austausch gewünscht. Sie haben ähnliche Bedenken wie die Verfasser*innen des offenen Briefs. Lukas, der an der Pressekonferenz teilgenommen hat, war zudem enttäuscht, dass die Institutsangehörigen bloss fünf Minuten vor der Pressekonferenz von der Universitätsleitung über die Folgen der Administrativuntersuchung informiert wurden. Zudem sei zu wenig über die Zukunft der Studierenden am Institut kommuniziert worden. «Werden die Studienpläne beibehalten? Was geschieht mit den Lehrenden? Wie sieht es mit geplanten Auslandsaufenthalten aus?» Sara empfand die Kommunikation insgesamt als nicht ausreichend. «Ich hätte mir eine aktive Aufarbeitung der inneruniversitären Prozesse und des Medienechos gewünscht, da ich mir sehr unsicher bin, welche Auswirkungen dieser Medienrummel auf meinen Abschluss und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wird, dies wurde jedoch nicht weiter berücksichtigt», so Sara.
Auch die Kommission für Internationales und Solidarität des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften hat in einem Positionspapier kürzlich darauf hingewiesen, dass an den Hochschulen ein «Klima des Schweigens» herrsche und Räume für wissenschaftliche, kritische und sachliche Diskussionen gefordert. Das Papier nimmt dabei explizit die Hochschulleitungen in die Mangel, denn diese würden ihrer Verantwortung nicht nachkommen, da sie keine solchen Räume bieten, sich nicht oder nur selektiv äussern und damit den medialen Aufruhr befeuern. So findet auch Sara:
«Nötig wäre ein Raum für eine differenzierte Diskussion rund um das Thema und die Art und Weise, wie in der Schweiz darüber gesprochen, oder eben nicht gesprochen wird. Die Universität wäre, zumindest in der Theorie, der richtige Ort um dies zu tun.»
Obschon die Debatte rund um die Geschehnisse am ISNO und die Kritik an der Wissenschaftlichkeit sowie der Wissenschaftsfreiheit, die Meinungen spaltet: Alle Menschen, mit denen ich für diesen Artikel im Austausch war, sind sich einig: Es fehlt an Raum für Diskussionen.