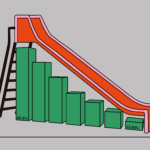Sichtbar ermächtigt

Virginia Richter ist geboren in der Tschechoslowakei und aufgewachsen in Deutschland. In Ihrer Freizeit schwimmt sie in der Aare, besteigt Berge und fährt Ski. Seit 2007 unterrichtet sie moderne englische Literatur an der Universität Bern. (Bild: Universität Bern)
Dass die Uni Bern im Sommer 2024 erstmals eine Frau als Rektorin bekommt, bedeutet noch lange nicht das Ende des Patriarchats. Ein Gespräch mit Virginia Richter über die Wichtigkeit von Vorbildern, Integrität und kleinen Wiesen jenseits der Karriere.
Liebe Frau Richter, ihre Wahl zur Rektorin rückt die männlich dominierte Geschichte der Uni Bern ins Rampenlicht. Sie setzten sich bereits vor 30 Jahren mit Geschlechterkonflikten auseinander. Was hat sich seit damals verändert?
Richter: Ich denke, dass es eine massive gesellschaftliche Entwicklung gegeben hat. Also nicht nur an der Uni, aber auch an der Uni. Als ich Anglistik studiert habe, was als Frauenfach galt, gab es in unserer Fakultät so gut wie keine weiblichen Führungspersonen. Wissenschaftler:innen mussten offiziell zwar nicht männlich sein, aber bindungslos. Wenn sie eine Familie hatten, musste sie sich anpassen und folgen. Heute reden wir viel mehr darüber, wie man Karriere und Familie unter einen Hut bringen kann. Auch für Väter natürlich.
Und trotzdem sind an der Uni Bern nur 30 % Professorinnen unter den Berufenen. Woher kommt das?
Richter: Für eine Berufung auf eine Professur braucht man gewisse Qualifikationen. Diese zu erwerben dauert lange. Doch ich denke, wir holen auf. Bei den neu Berufenen sind schon knapp 40 % Frauen. Aber es ist richtig, dass besonders nach dem Doktorat ganz viele Frauen «rausfallen». Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Zeit bei Frauen mit dem biologischen Alter der Familiengründung zusammenfällt. Und es ist auch genau diese Zeit, die Postdoc-Phase, die entscheidend für die wissenschaftliche Karriere ist.
Das Kernproblem ist die Vereinbarkeit von Familie und Karriere?
Richter: Es ist eines der wesentlichen Probleme. Aber es sind auch gesellschaftliche Faktoren wie Rollenbilder, wie das Bild der Mutter. Von Frauen wird viel stärker erwartet als von Männern, dass sie Zeit in die Familie investieren. Darum sind auch Vorbilder so wichtig. Wenn in den Führungsetagen nur Männer sind, dann überlegen sich Frauen natürlich ganz rational, ob es sich lohnt, zu versuchen, dorthin zu gelangen. Je mehr Frauen sichtbar sind in Professuren und Forschungsgruppen, desto rationaler wird die Entscheidung für Frauen, diesen Weg einzuschlagen.
Dem Mangel zum Trotz werden Sie zum Vorbild. Aber was für ein Vorbild möchten Sie sein?
Richter (lachend): Also ich bin schon froh, wenn ich es ordentlich mache. Aber ich glaube, ich möchte nicht nur in der beruflichen Rolle aufgehen. Man sagt ja auch: Ich habe Freizeit. Auch ich mache andere Dinge, ausser nur zu arbeiten. Ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Aber es gibt trotzdem noch irgendwie was anderes. Ich möchte integer sein. Es gibt auch bestimmte Werte, die für mich wichtig sind, die ich sichtbar machen will.
Welche Werte sind Ihnen am wichtigsten?
Richter: Integrität, persönliche Redlichkeit, Glaubwürdigkeit. Auf andere zugehen können. Das ist zwar kein Wert, aber eine Fähigkeit, die ich für sehr wichtig halte.
Integrität bedeutet, zu den eigenen Werten zu stehen?
Richter: Und sich nicht nur von Eigeninteresse leiten zu lassen. In der Forschung ist das ein Schlüsselwert: sich nicht unter Zwang setzen zu lassen, bloss weil fremde Erwartungen an einen herangetragen werden. Es ist auch wichtig, eine Fehlerkultur zu haben. Jeder Mensch macht natürlich Fehler und ich möchte sagen können: «Nein, da habe ich mich geirrt. Ich versuche es zu korrigieren.»
« Ich möchte sagen können: Nein, da habe ich mich geirrt. Ich versuche es zu korrigieren. »
Apropos korrigieren: Ist die Uni Bern genug offen, oder ist das etwas, was Sie verändern möchten?
Richter: Also das wird so nicht unbedingt gesagt, aber es ist ein Bewusstsein bei vielen da, dass wir eine weisse¹ Universität sind. Ich kann als Rektorin aber nicht in das Berufungsverfahren eingreifen. Je diverser der Pool der Bewerberinnen und Bewerber wird, desto diverser werden dann auch die Berufungen. Es ist schwer, das zu steuern. Ich kann nicht Quoten verhängen in einem System, wo es letztlich auf die wissenschaftlichen Profile ankommt.
Wo würden Sie ansetzen?
Richter: Ich komme zurück auf die Vorbilder. Möglich wäre zum Beispiel, Professor:innen, die nicht der Heteronormativität entsprechen oder People of Color zu fragen, ob sie Dekanin oder Dekan werden wollen. Man muss dabei aber vorsichtig sein, dass man sie nicht benutzt und exotisiert.
In einem Artikel mit dem Bund haben Sie gesagt, dass die Sichtbarkeit von Frauen wichtig ist. Warum die Sichtbarkeit und nicht die Ermächtigung?
Richter: Ich denke, Sichtbarkeit und Ermächtigung gehen Hand in Hand. In diesen ersten Tagen, nachdem meine Wahl als Rektorin bekannt geworden ist, war ich überwältigt von den vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, von Frauen, die ich nicht kenne. Sie haben geschrieben, sie fühlten sich besser repräsentiert, besser gesehen. Aber Sie haben völlig recht: Das Gesehenwerden allein reicht nicht, man muss natürlich den Einfluss, den man hat, entsprechend nutzen.
Wäre es möglich, Ihren Einfluss zu nutzen, um mehr Frauen eine Professur zu geben?
Richter: Da ich für eine partizipative Führung einstehe, bin ich sehr zurückhaltend mit solchen Forderungen und Versprechungen. Man kann immer nur Bedingungen schaffen und versuchen die Leute dafür zu gewinnen. Schwierig daran ist, dass schnelle Veränderungen so nicht leicht möglich sind, aber andererseits werden Änderungen, die dann passieren, von allen mitgetragen.
Viele Männer würden jedoch nichts am System verändern, wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Können wir das Patriarchat durch Überzeugungsarbeit überwinden?
Richter: Natürlich gibt niemand gern was ab. Es ist einfach so: Eine Professur ist eine mächtige Position und es ist angenehm, Personal zu haben, welches einem zuarbeitet und Anspruch auf Laborplätze zu haben… Wenn ich als etablierter Professor der jüngeren Kollegin etwas abgebe, dann verliere ich dadurch. Andererseits ist es meine Erfahrung, dass ich in meinem direkten Umfeld sehr viel Unterstützung von Männern bekommen habe und dass auch die Männer heute nicht wie meine alten, weissen Professoren sind, bei denen ich damals studiert habe. Meine heutigen Kollegen sind Männer, die Judith Butler gelesen haben, die sensibler und offener geworden sind. Als Feministin habe ich manchmal mit Männern Allianzen geschlossen, um verschiedene Anliegen voranzubringen. Und das funktioniert – aber natürlich nicht mit allen Männern.
Welchen Satz würden Sie über den Eingang des Hauptgebäudes schreiben?
Richter (nach längerem Nachdenken): Tretet ein: Wissenschaft macht glücklich.
***
interview: florian rudolph
Dieser Beitrag erschien in der bärner studizytig #33 Oktober 2023
Die SUB-Seiten behandeln unipolitische Brisanz, informieren über die Aktivitäten der StudentInnenschaft der Uni Bern (SUB) und befassen sich mit dem Unialltag. Für Fragen, Lob und Kritik zu den SUB-Seiten: redaktion@sub.unibe.ch
Die Redaktion der SUB-Seiten ist von der Redaktion der bärner studizytig unabhängig.
______________
¹ «weiss» wird absichtlich klein und kursiv geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um eine biologische Eigenschaft und reelle Hautfarbe, sondern vielmehr um eine politische und soziale Konstruktion handelt. Als weisse Menschen werden jene bezeichnet, die nicht von Rassismus betroffen sind (Bla*Sh, 2019).