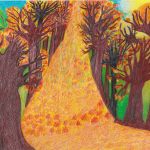Mindbalance – ein Tropfen auf den heissen Stein der psychischen Abgründe Studierender

Zwei Studierende im Gespräch mit Pierre-Alain Emmenegger.
Es liegt in aller Munde, dass viele junge Menschen psychisch nicht besonders stabil sind. Und doch scheint kaum jemand etwas dagegen zu unternehmen. Oder etwa doch? Ich machte mich auf die Suche nach Antworten bei Mindbalance; einem studentischen Verein an der Universität Bern, der sich die Sensibilisierung der psychischen Gesundheit auf die Fahne schreibt.
Es gibt scheinbar unendlich viele Gruppierungen, die mit der SUB und der Universität Bern zusammenhängen. Das Spektrum reicht von kulturellen über politische bis hin zu religiösen Vereinigungen, geschweige denn den Gruppierungen, die sich gar nicht erst in eine dieser Kategorien zwängen lassen. Es gäbe also eine beträchtliche Anzahl von Gruppierungen, die sich nur zu gut porträtieren liessen, doch mein Augenmerk in dieser Reportage gilt nur einer einzigen, die meiner Ansicht nach besonders viel Aufmerksamkeit verdient: Mindbalance, eine Gruppierung, die sich mit Herzblut der mentalen Gesundheit von Studierenden widmet.

Einige Mitglieder von Mindbalance beim Event „Einblick in die Psychotherapie“.
Um mehr über Mindbalance zu erfahren, sprach ich mit Ricarda, einer der Gründer*innen und treibenden Kräfte des jungen Vereins.
Interview mit Ricarda
Kannst du als eine der Gründer*innen erzählen, wie es zu Mindbalance kam?
Als ich mich selbst aus psychischen Gründen in Therapie begeben wollte, habe ich zuerst einmal universitäre Angebote gegoogelt und war ziemlich ernüchtert, weil ich kaum etwas fand. Auch fiel mir auf, dass es keinen Studierendenverein gab, an den ich mich hätte wenden können. Mindbalance entstand daher ursprünglich aus meinen eigenen Bedürfnissen.
Ich habe den Verein dann mit zwei anderen Studierenden gegründet. Indem alle Beteiligten immer mehr Menschen miteinbrachten, wuchs Mindbalance stetig.
Was ist dein Eindruck, wie geht es den Studierenden an der Universität Bern?
Das ist schwierig zu beurteilen. Wir haben mit Mindbalance einmal eine kleine Umfrage gemacht, bei der wir 250 Studierende zu ihrem psychischen Wohlbefinden befragten. Ein Drittel der Befragten gab an, es gehe ihnen psychisch schlecht, davon hatte wiederum rund ein Drittel eine Diagnose. Dieses Resultat stimmt in etwa mit anderen Studien überein. Besonders interessant war für uns, dass etwa zwei Fünftel der Befragten nicht wussten, an wen sie sich bei einer psychischen Krise wenden könnten. Von 250 Befragten kannten nur gerade 16 Personen die Beratungsstelle der Universität[1], von ihnen haben wiederum nur drei Personen einmal von ihr Gebrauch gemacht.
[1] Die Beratungsstelle der Berner Hochschulen unterstützt Studierende nicht nur bei Ängsten, Krisen und Schwierigkeiten, die mit dem Studium zusammenhängen, sondern auch bei privaten Angelegenheiten. Die Angebote der Beratungsstelle sind kostenlos. Mehr Informationen findest du unter: www.bst.bkd.be.ch.
„Von 250 Befragten kannten nur gerade 16 Personen die Beratungsstelle und von ihnen haben wiederum nur drei Personen einmal von ihr Gebrauch gemacht.“
Ist es auch in deinem persönlichen Umfeld spürbar, dass es vielen jungen Menschen nicht gut geht?
Ja, ich merke schon, dass es nicht allen gut geht. Depressionen sind bei Studierenden, aber auch in der restlichen Bevölkerung am häufigsten unter den psychischen Erkrankungen. Generell fällt mir auf, dass es eine grosse Tabuisierung rund um psychische Probleme gibt und viele junge Menschen sich alleingelassen mit ihrem Problemen fühlen. Es gibt eine Anlaufstelle an der Universität, diese scheint aber für viele Studierende zu wenig sichtbar zu sein.
Woran liegt es denn, dass gerade viele Studierende mit psychischen Erkrankungen, wie etwa Depressionen kämpfen?
Bei den Studierenden ist der Leistungsdruck oft besonders gross. Auch die immense Vielfalt an Möglichkeiten, die sich Student*innen eröffnen, kann eine gewisse Ohnmacht hervorrufen. Oft stehen Studierende vor einem Umbruch im Leben und die Möglichkeiten müssen sorgfältig abgewogen werden. Auch eine geregelte Tagesstruktur kann bei einer hohen psychischen Belastung unterstützend wirken, eine solche fehlt im Studienleben oft weitgehend.
„Bei den Studierenden ist der Leistungsdruck oft besonders gross und auch die immense Vielfalt an Möglichkeiten, die sich Student*innen eröffnen, kann eine gewisse Ohnmacht hervorrufen.“
«Mindbalance» ruft schon einige Assoziationen hervor. Willst du vielleicht trotzdem kurz erklären, wer ihr seid und was ihr macht?
Gerne. Wir sind ein offizieller, eingeschriebener Studierendenverein der Universität Bern, der sich vor allem aus Medizin- und Psychologiestudierenden zusammensetzt. Wir sind aber offen für alle! Unser Fokus liegt auf der psychischen Gesundheit der Studierenden, nicht unbedingt auf den psychischen Krankheiten. Wir arbeiten also eher präventiv. Wir wollen sensibilisieren und enttabuisieren und insbesondere auch Hilfe sichtbarer machen. Dies tun wir mittels Workshops, Projekten, Vorträgen und unserer Website, die ebenfalls als Infoplattform fungiert.
Was bietet Mindbalance konkret? Inwiefern unterstützt ihr Studierende?
Wir haben schon diverse Anlässe durchgeführt. Beispielsweise am World Mental Health Day, am 10. Oktober. Da haben wir verschiedene Vorträge organisiert, darunter auch einen über Suizidalität. Wir machten auch schon einen Meditationsanlass, etwas zu «climate anxiety» oder es gab einen Vortrag über Essstörungen bei Männern. Geplant ist ausserdem ein Töpfer- und ein Yogakurs, bei denen sich die Finanzierung momentan aber noch etwas schwierig gestaltet.
Ist es nicht gefährlich, dass ihr als Laien zu viel versprecht und dann doch nicht wirklich helfen könnt?
Nein, wir haben schon immer betont, dass wir kein Therapieangebot bieten. Wir sind keine Fachpersonen und unsere Aufgabe ist es, zu vermitteln und zu informieren, das kommunizieren wir auch so nach aussen. Wir wollen, wie gesagt, vor allem präventiv arbeiten und sensibilisieren. Wenn jemand psychisch krank ist und ernsthaft Hilfe braucht, verweisen wir diese Person auf eine professionelle Therapie.
Was wünschst du dir von der Uni im Hinblick auf die psychische Gesundheit Studierender?
Ich wünsche mir, dass psychische Probleme gezielt adressiert werden und deutlich gemacht wird, dass es Hilfe gibt von der Universität aus. Dies könnte zum Beispiel auch von den Dozierenden kommuniziert werden. Mindbalance könnte finanzielle Unterstützung gebrauchen, damit die psychische Gesundheit von Studierenden noch besser unterstützt werden kann.
Auf eurer Website springt einem der «Irrsinnig»-Podcast direkt ins Auge. Wie hängt dieser Podcast mit Mindbalance zusammen?
Die Idee für den Podcast kam von mir. Beim Podcast geht es darum, auf eine einfache Art und Weise den Dialog zu finden über die psychische Gesundheit, der zu einer Sensibilisierung und Enttabuisierung führt. Wir alle sprechen zu wenig über diese sensiblen Themen. Den Zuhörer*innen soll klar werden, dass sie nicht allein sind und dass es oftmals schon hilft, darüber zu sprechen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, heisst es doch so schön. Wir wollen mit dem Podcast nicht aufklären, sondern es soll ein lockeres Gespräch sein, bei dem jede*r dabei sein kann.
„Der Podcast soll zu einer Sensibilisierung und zu einer Enttabuisierung führen und den Dialog unter den Studierenden eröffnen.“
Der Irrsinnig-Podcast feierte gerade seinen ersten Geburtstag. Was ist deine Zwischenbilanz?
Die Bilanz ist bis jetzt durchgehend positiv. Wir bekommen Tipps, Komplimente aber auch hilfreiche Kritik. Letzten Samstag sagte ein Freund zu mir, es bringe ihm schon nur etwas, sich mit Themen zu beschäftigen, welche die Psyche angehen. Für ihn sei der Podcast sehr lehrreich und ein guter Denkanstoss.
…und für dich persönlich?
Für mich sind vor allem die Gespräche sehr wertvoll. Die Personen, die in den Podcast kommen, gehen jeweils beeindruckend offen mit diesen anspruchsvollen Themen um, für mich sind sie deshalb echte Vorbilder. Ich habe durch den Podcast mit reflektierten Menschen zu tun, von denen ich auch persönlich viel lernen kann.
Was wünschst du dir für die Zukunft für den Podcast?
Von mir aus kann es gerne so weiter gehen, am liebsten natürlich mit noch mehr Zuhörer*innen und ganz vielen verschiedenen Themen. Bis jetzt befanden wir uns im Podcast leider noch ein wenig in unserer «Bubble», also in einem akademischen, weiss geprägten Umfeld. Wir würden unsere Themen gerne erweitern auf People of Colour, LGBTQ+ und auch mehr Gespräche mit Fachpersonen führen.
Hier geht’s zum Irrsinnig-Podcast!

Ricarda Eijer – Die Gründerin von Mindbalance.
Ein Einblick in die Psychotherapie
Nach unserem Interview ging es für mich und Ricarda gleich weiter zu einem Event von Mindbalance, bei dem es darum ging, Teilnehmenden einen Einblick in die Psychotherapie zu ermöglichen.
Als wir im hell erleuchteten Seminarraum der UniS ankamen, schauten wir in freundliche Gesichter von Mindbalance- Mitgliedern, die gerade damit beschäftigt waren, ein Apéro vorzubereiten und den Raum für den Abend herzurichten.
Während immer mehr Menschen eintrudelten, suchte ich das Gespräch mit einigen Medizinstudierenden. Diese bekundeten ihren Unmut darüber, dass im Medizinstudium nicht eine einzige Vorlesung zum Thema Psychotherapie angeboten werde, obwohl das Interesse unter den Studierenden riesig sei. Umso mehr schätzten sie diesen von Mindbalance indizierten und durchgeführten Anlass, bei dem drei Berner Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie zu Wort kamen.
Als das Publikum komplett war, ergriff Pierre-Alain Emmenegger, einer der drei Psychotherapeuten, das Wort. Zusammen mit seinen beiden Kollegen Robert Fischer und Claude Rui hatte er sich bereit erklärt, den wissensdurstigen Studierenden einen Einblick in die Psychotherapie zu ermöglichen.

Diskussion zwischen den drei Psychotherapeuten und dem Publikum.
Nach der kleinen Einleitung von Pierre-Alain Emmenegger ging es direkt zur Kernfrage: Wie werden psychisch kranke Menschen therapiert? Um dies zu illustrieren, wurde eine Videosequenz abgespielt. Wir Zuschauer*innen erhielten einen Einblick in eine erste Art zu therapieren, nämlich derjenigen von Pierre-Alain Emmenegger. Robert Fischer und Claude Rui ergänzten mit Ausführungen zu ihren eigenen Methoden und Vorgehensweisen. So entwickelte sich ein lockerer Dialog zwischen den Experten. Auch das Publikum wurde eingebunden und es entstand ein sicherer Raum für Fragen, Anregungen und Diskussionen.
Bei Mandarinen, Nüsschen und anderen Snacks wurden in der Pause die Gespräche und Gedanken in kleineren Gruppen weitergesponnen.

Eine Gruppe Studierender im Gespräch mit Robert Fischer.
Nach der Pause blieb noch genügend Zeit für Fragen und Anregungen der rund vierzig motivierten Zuschauer*innen.
Auf dem Heimweg durch die kühle Februarluft liess ich mir den Abend noch einmal durch den Kopf gehen. Eine angenehme, bereichernde und lehrreiche erste Begegnung mit Mindbalance lag hinter mir. Es gibt mir Hoffnung und Zuversicht zu wissen, dass es Menschen an der Universität gibt, die sich für die psychische Gesundheit von mir und allen anderen Studierenden einsetzen.
Falls du gerne etwas im Bereich psychische Gesundheit von Studierender an der Uni Bern bewegen möchtest oder einfach nur mehr erfahren willst, zögere nicht und melde dich bei dieser aufgeschlossenen Truppe.
text und fotos: noëlle schneider
***
Dieser Beitrag erschien in der bärner studizytig #31 März 2023
Die SUB-Seiten behandeln unipolitische Brisanz, informieren über die Aktivitäten der StudentInnenschaft der Uni Bern (SUB) und befassen sich mit dem Unialltag. Für Fragen, Lob und Kritik zu den SUB-Seiten: redaktion@sub.unibe.ch
Die Redaktion der SUB-Seiten ist von der Redaktion der bärner studizytig unabhängig.